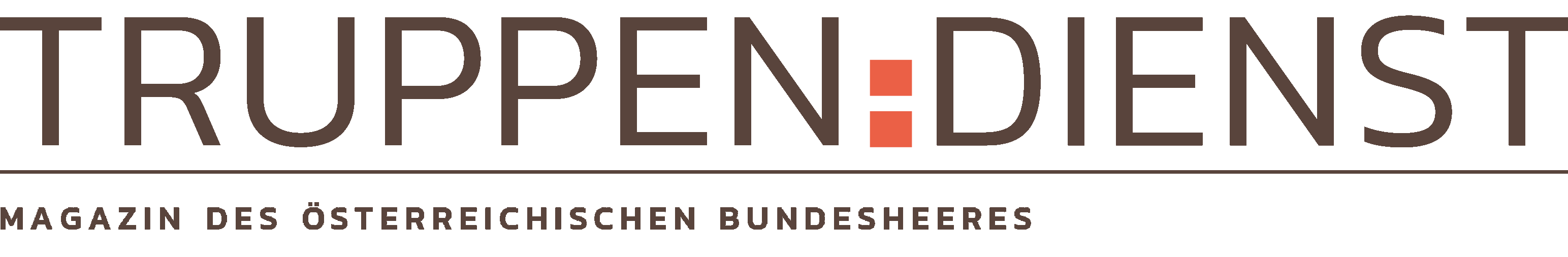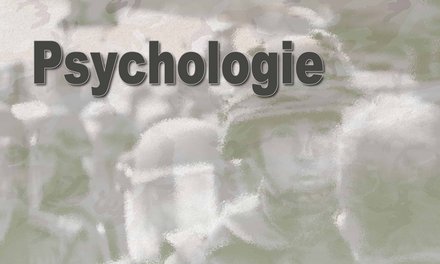Konflikt - Gestern. Heute. Morgen. Teil 2

Der zweite Teil dieser Serie beschäftigt sich mit sogenannten „nicht internationalen bewaffneten Konflikten“, aber auch mit einer weiteren Form der (bewaffneten) Auseinandersetzung - den „Neuen Kriegen“. Das sind Konflikte, mit denen die Soldaten des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) insbesondere bei Auslandseinsätzen konfrontiert sind. Diese Konfliktformen werden in vielen Fällen als „asymmetrische Konflikte“ beschrieben.
Neben der Unterscheidung nach konventionellen, nicht konventionellen, und subkonventionellen Konflikten (siehe TD-Heft 358, S. 200 ff., Teil 1) ist es notwendig, zwischen symmetrischen und asymmetrischen Konflikten zu differenzieren. Erst diese Unterscheidungsmerkmale ermöglichen den wahren Charakter derartiger Auseinandersetzungen zu erkennen, die diffizilen Bestrebungen der beteiligten Akteure zu verifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu setzen. In weiterer Folge werden die unterschiedlichen Sub-Typen dieser Konflikte betrachtet und entsprechende Schlussfolgerungen für Einsätze des Bundesheeres gezogen.
Im ersten Teil der Serie wurde der Schwerpunkt auf die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten gelegt. Dabei wurde festgestellt, dass ein Krieg zwischen Staaten durch das Völkerrecht als „internationaler bewaffneter Konflikt“ normiert ist. Völkerrechtlich ist diese Konfliktform verboten („Gewaltverbot“) und deswegen, aber auch aufgrund der möglichen Auswirkungen („Nukleare Extermination“; nukleare Vernichtung) für die meisten Staaten kein Mittel ihrer Politik zur Durchsetzung ihrer Interessen.
In den diversen Medien wird der Staatsbürger mit Berichten über gewaltsame Auseinandersetzungen, Tod, Flucht und Vertreibung von Menschen überhäuft. „Krieg“ findet scheinbar permanent statt. Allerdings hat dieser Krieg nichts mit jenen Kriegen zu tun, die im ersten Teil behandelt wurden. Das ÖBH muss sich in seinen Auslandseinsatzambitionen künftig vielmehr auf „nicht internationale bewaffnete Konflikte“ und „Neue Kriege“ vorbereiten, um einen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität leisten zu können.
Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) veröffentlicht seit 25 Jahren ein „Konfliktbarometer“. Im Jahr 2016 wurden in diesem Bericht insgesamt 401 Konflikte weltweit erfasst. Auch wenn die Mehrheit dieser Konflikte nicht mit Gewalt ausgetragen wird, so zeigt sich dennoch, dass die Ordnungsversuche der internationalen Staatengemeinschaft in vielen Fällen scheitern. Interessant ist, dass von diesen 401 Konflikten insgesamt 319 auf inner- oder substaatlicher Ebene ausgetragen werden (dies entspricht 79,5 Prozent).
Diese Zahlen zeigen, dass das Thema der „nicht internationalen bewaffneten Konflikte“ eine große Bedeutung hat. Anders ausgedrückt: Betrachtet man die Auslandseinsätze des ÖBH, zeigt sich ein Trend: Die klassischen Blauhelmeinsätze zur Überwachung von Waffenstillständen zwischen Staaten (z. B. United Nation Disengagement Observer Force/UNDOF) gehen zurück und gleichzeitig steigen jene Einsätze mit weitreichenden Mandaten und einer dementsprechend erforderlichen Kampfkraft (z. B. United Nation Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali/MINUSMA).
Ziel aller Bestrebungen muss es sein, einen Beitrag zur Stabilisierung des Umfeldes Europas, respektive der EU, und somit letztlich für die Sicherheit Österreichs, seiner Einwohner und deren Lebensgrundlagen zu leisten.
Symmetrie und Asymmetrie
Viele „nicht-internationale bewaffnete Konflikte“ sowie „Neue Kriege“, wie sie derzeit weltweit auftreten, werden auch als asymmetrische Konflikte bezeichnet. Daher ist es zunächst wichtig zu verstehen, wie sich symmetrische von asymmetrischen Konflikten unterscheiden.
In der europäischen Militärgeschichte bezieht sich die Symmetrie der aufgebotenen militärischen Kräfte nicht auf deren Gleichheit bzw. gleiche Stärke, sondern auf deren Gleichartigkeit. Diese Gleichartigkeit lässt sich nach dem Politikwissenschafter Herfried Münkler anhand dreier Kriterien überprüfen.
Rekrutierung
Handelt es sich um ein eilig aufgebotenes und tendenziell eher kurz ausgebildetes Volksheer, das den Gegner in einem permanenten Krieg zermürben will oder wird eine bestimmte Bevölkerungsgruppe rekrutiert, die über einen längeren Zeitraum trainiert wird, bevor sie in den Krieg geschickt wird? Es ist eine Frage der Professionalisierung der Streitkräfte.
Bewaffnung
Werden die militärischen Kräfte nach dem Prinzip der Selbstequipierung (Selbstausstattung) bewaffnet oder stellen sie ein Instrument eines politischen Körpers dar, der sie einheitlich ausrüstet, bewaffnet und versorgt?
Ausbildung
Wie lange dauert die Ausbildung und in welcher Intensität wird sie durchgeführt? Die Spanne reicht dabei von der Schulung der individuellen Fertigkeiten des Soldaten bis hin zum abgestimmten Vorgehen taktischer Formationen. Eine Symmetrie liegt vor, wenn die Gleichartigkeit der gegeneinander kämpfenden Soldaten in diesen drei Kriterien gegeben ist. Gerade die völkerrechtlichen Verträge der europäischen Neuzeit zielten auf diese Form der Gleichartigkeit ab.
Auf der anderen Seite sind asymmetrische Konflikte kein neues Phänomen innerhalb der Kriegsgeschichte. Nach Münkler ist das Gegenteil der Fall: „Asymmetrische Konfliktformen sind älter als die symmetrischen und in diesem Sinne ist der europäische Sonderweg der Symmetrie innerhalb der Kriegsführung eher eine Ausnahme. Die militärisch-technischen Entwicklungen im 16./17. Jahrhundert, wie die Entwicklung der Artillerie und die Verwandlung der Fußtruppen in eine exerzierende Infanterie, wurden von allen europäischen Staaten nachvollzogen und zusammen mit der sich konsolidierenden Staatlichkeit führte dies zu einer Gleichartigkeit bzw. Symmetrierung.“
Dieser europäische Sonderweg ist aber nach Münkler seit langem beendet, und damit haben auch alle politischen und rechtlichen Instrumente, die unter den Bedingungen der Symmetrie entwickelt worden sind, zur Einhegung und Kodifizierung des Krieges massiv an Bedeutung verloren. Die Idee, den „Krieg“ rechtlich zu verbieten und so eine friedliche Welt zu schaffen, hat sich nicht erfüllt. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen.
So ist die Verletzlichkeit von modernen Gesellschaften dramatisch angewachsen. Deren Infrastruktur ist komplexer und damit auch fragiler als die agrarischen und frühindustriellen Gesellschaften. Auch die Attraktivität, Bodenschätze und Territorien zu erobern, hat abgenommen, da es kostengünstiger ist, die Ressourcen zu kaufen, als sie mit Waffengewalt zu erobern. Dies wird noch durch die Aufrechterhaltung und Stabilisierung des freien Welthandels verstärkt. Nach den Politikwissenschaftern Irene Etzersdorfer und Herfried Münkler steht auch die Entwicklung von postheroischen Mentalitäten in modernen Gesellschaften der Führung von verlust- und entsagungsreichen Kriegen entgegen.
Aber auch im Europa der Kriegsgeschichte mit grundsätzlich symmetrischer Kriegsführung, waren immer Formen der asymmetrischen Kriegsführung vorhanden. Sie waren, vor allem seit 1648, allerdings nicht die Hauptformen, sondern Begleiterscheinungen des Krieges. Während der „Große Krieg“ die klassischen, symmetrischen Feldzüge bezeichnet, wurden diese immer durch den so genannten „Kleinen Krieg“ begleitet. Dieser konnte auch durch reguläre Truppen geführt werden, um z. B. Aufklärung zu betreiben, aber auch um die gegnerische Versorgung durch Hinterhalte und Überfälle zu stören. Bekannter in der Kriegsgeschichte sind allerdings Volkserhebungen, wie die spanische Guerilla (Kampf der Spanier gegen Napoleon auf der Iberischen Halbinsel 1809 bis 1812), aber auch die der Tiroler unter Andreas Hofer gegen Napoleon.
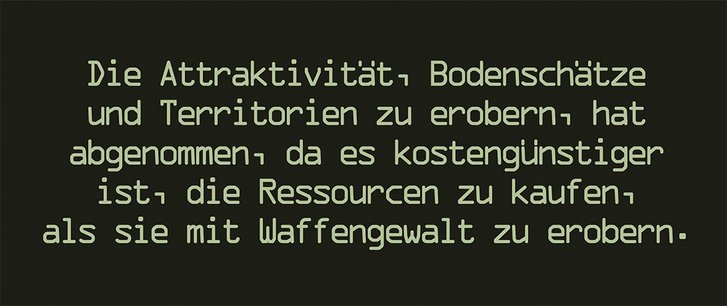
Den Asymmetrie-Begriff als Synonym für den Partisanenkrieg bzw. die Guerilla zu gebrauchen, ist, nach Münkler, allerdings falsch. Dieser unterscheidet grundsätzlich zwischen Asymmetrien aus Stärke (Asymmetrie) und Asymmetrien aus Schwäche (Asymmetrierung): „Asymmetrie entsteht dadurch, dass eine Seite durch permanente militärorganisatorische und waffentechnische Innovationen gegenüber einem Kontrahenten einen Vorsprung gewinnt, den dieser innerhalb eines politisch relevanten Zeitraums nicht mehr wettmachen kann.“
In der Regel geschieht dies durch die Fähigkeiten, den Kampf über eine Distanz führen zu können, in der der Kontrahent keine Möglichkeit der gleichartigen Verteidigung besitzt, wie der Einsatz von Seestreitkräften gegenüber reinen Landarmeen, von Luftwaffen gegen einen Gegner ohne eigener Luftwaffe oder geeigneter Luftabwehr oder die Steuerung von Lenkwaffen aus dem Weltraum heraus. Der Einsatz von Drohnen, Satelliten etc. in Afghanistan durch die ISAF/RSM-Truppen ist ein anschauliches Beispiel für eine solche Asymmetrie. „Dem steht die als Asymmetrierung bezeichnete Reaktion der organisatorisch wie technisch Unterlegenen gegenüber, die sich mit Hilfe kreativer Strategien und Taktiken dem Zugriff der überlegenen Seite zu entziehen versuchen, etwa wenn sie nicht mehr dem strategischen Prinzip einer Konzentration der militärischen Kräfte in Raum und Zeit folgen, sondern an dessen Stelle die Verstreuung der Kräfte im Raum und die Ausdehnung des Krieges in der Zeit setzen.“
Daher bedeutet Asymmetrierung, dass man sich dem Gegner nicht dort zum Kampf stellt, wo dieser mit Sicherheit seine Überlegenheit (technisch bzw. organisatorisch) ausspielen kann, sondern die militärische Konfrontation in Bereichen sucht, wo man dessen Schwächen und Verwundbarkeiten ausgemacht hat. Die Idee der Asymmetrie aus Schwäche beruht im Prinzip auf dem Grundsatz der Unerkennbarkeit der Kämpfer durch den Gegner, womit ein Gegenpol zur Unerreichbarkeit durch den Gegner bei der Asymmetrie gebildet wird.
Eine Hauptform des Kampfes durch Asymmetrierung bildet dabei der Partisanenkampf, der jedoch im Wesentlichen defensiv ausgerichtet ist. Partisanen benötigen die nachhaltige Unterstützung der Zivilbevölkerung, um sich ihren Gegnern zu entziehen und sich zu versorgen. Im Gegensatz dazu ist der Terrorismus im Wesentlichen - zumindest potenziell - offensiv ausgerichtet. Er ist nicht auf die direkte Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen und kann die Infrastruktur seines Gegners als Waffe aber auch als logistische Basis nutzen. Damit kann der Terrorismus, im Gegensatz zum Partisanenkampf, auch in das Territorium seiner Gegner getragen werden.
Potenzielle Akteure können jedoch diese unterschiedlichen Kampfweisen zu ihrer Zielerreichung auch in einem „Dreistufenmodell“ anwenden. In der ersten Stufe dienen Terrorakte dem Ziel, der Bevölkerung die Verletzlichkeit des repressiven Apparates zu zeigen bzw. diesen Apparat zu übertriebenen Reaktionen zu verleiten.
In der zweiten Stufe erfolgt ein Partisanenkampf oder ein bewaffneter Aufstand in den Städten. Durch die Verschiebung der Raum- und Zeitkomponenten im Kampf soll der Gegner mittel- bis langfristig geschwächt werden, um eine weitgehende Symmetrie herzustellen. Diese soll in der dritten Stufe des Kampfes zu einer militärischen Entscheidung führen.
Dieses Modell darf jedoch nicht als lineare Abfolge der Stufen verstanden werden, vielmehr ist ein lageangepasster Wechsel zwischen diesen Stufen möglich. Droht beispielsweise die „militärische“ Vernichtung, so besteht die Möglichkeit, in den klassischen Partisanenkampf zurückzukehren. Sollte auch in diesem Bereich der Druck des Gegners zu groß werden, besteht eine weitere Rückfalloption in Terrorakte.
„Nicht internationale bewaffnete Konflikte“
Völkerrechtlich werden „nicht internationale bewaffnete Konflikte“ im II. Zusatzprotokoll 1977 zu den Genfer Abkommen definiert. Sie umfassen jene Konflikte „die im Hoheitsgebiet einer Hohen Vertragspartei zwischen deren Streitkräften und abtrünnigen Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Vertragspartei ausüben, dass sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen durchführen und dieses Protokoll anzuwenden vermögen.“ Vereinfacht ausgedrückt werden damit zwei Konfliktformen angesprochen.
Zum Ersten sind das klassische Bürgerkriege zwischen Regierungstruppen und Aufständischen bzw. Befreiungsbewegungen, die durch die Vereinten Nationen als solche anerkannt werden. Diese Form der Bürgerkriege war insbesondere in den Unabhängigkeitskonflikten bei der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg relevant. Nachdem heute de facto keine Kolonien mehr existieren, ist diese Konfliktform in den Hintergrund gerückt. Zum Zweiten sind das Konflikte, die zwischen nicht- oder substaatlichen Akteuren stattfinden, also Konflikte, die sich zwischen zwei politischen oder religiösen Gruppen innerhalb eines Staates abspielen.
Um als nicht internationaler bewaffneter Konflikt durch die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere durch die Vereinten Nationen, anerkannt zu werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Zum Ersten ist die Polizei zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit nicht (mehr) in der Lage, wodurch der Einsatz der Streitkräfte erforderlich wird. Zum Zweiten müssen nicht-staatliche bewaffnete Gruppen über eine Führungshierarchie, einen Organisationsgrad und die Kontrolle über ihre bewaffneten Kräfte verfügen. Zum Dritten muss der Konflikt eine gewisse Kontinuität, also eine bestimmte Dauer, aufweisen. Und schließlich üben die nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen die Kontrolle über ein gewisses Territorium aus.
Die derzeit noch gültigen völkerrechtlichen Grundlagen für nicht internationale bewaffnete Konflikte sind zum Teil knapp 70 Jahre alt. Auch wenn sie durch unterschiedliche Zusatzprotokolle erweitert und präzisiert wurden, weisen sie einige Schwachstellen auf. Zum einen ist das Völkerrecht sehr stark auf Staaten konzentriert. Selbst bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten wird in Ausübung des Völkerrechtes angenommen, dass die Konfliktparteien einen eigenen Staat errichten und international anerkannt werden wollen. Dieser Ansatz hat bei den Unabhängigkeitskriegen funktioniert.
Die Kämpfer dieser Unabhängigkeitsbewegungen wollten nicht länger die Kolonialisierung eines anderen Staates ertragen, sondern selbst einen Staat gründen. Heute zeigt sich jedoch, dass viele bewaffnete Gruppen und Milizen gar keinen Staat gründen wollen, sondern andere, meist wirtschaftliche oder religiöse Ziele verfolgen. Zum anderen regelt das Völkerrecht für nicht internationale bewaffnete Konflikte nur das ius in bello, also die Rechte und Pflichten der kämpfenden Parteien. Es wird aber nicht geregelt, wer überhaupt die Legitimität besitzt zu kämpfen (ius ad bellum).
„Neue Kriege“
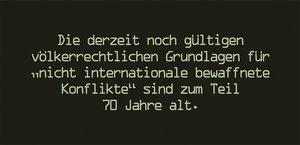
Neben dem völkerrechtlich definierten „nichtstaatlichen bewaffneten Konflikt“ gibt es etwas „Neues“ in Form der (bewaffneten) Auseinandersetzung innerhalb eines Staates. Die durch und durch symmetrische Konfrontation zwischen den Blöcken des Kalten Krieges verdeckte jedoch durch seine möglichen massiven Auswirkungen einen wichtigen Aspekt der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Mehr als zwei Drittel aller Kriege, die nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurden, waren keine klassischen Staatenkriege, aber auch teilweise keine „nichtstaatlichen bewaffneten Konflikte“. In der Literatur finden sich unterschiedliche Ansätze, wie diese Kriege begrifflich zu klassifizieren wären. Verschiedene Termini werden dafür angeboten, Low-intensity-conflict, kleine Kriege, wilde Kriege, Bürgerkriege, substaatliche Kriege, transnationale Kriege etc.
Der wohl bekannteste Begriff ist jener der „Neuen Kriege“. Irene Etzersdorfer beschreibt die „Neuen Kriege“ wie folgt: „Charakteristika der neuen Gewaltstrategien sind stark asymmetrische Konfliktlagen, in welchen Elemente des konventionellen Krieges, des Guerillakrieges, des Bürgerkrieges, der Bandenkriminalität, des transnationalen Verbrechens und Terrorismus zu finden sind. Jenseits aller Unterschiede brechen diese neuen Konflikte vorwiegend dort aus, wo Staaten ihr Gewaltmonopol wieder an die Gesellschaft verlieren bzw. dieses, bei näherer Betrachtung, nie wirklich besaßen, so dass sich Gewaltmärkte (re-privatisieren) und von substaatlichen Akteuren übernommen werden.“
Ein Merkmal der „Neuen Kriege“, das sowohl von Herfried Münkler und Irene Etzersdorfer als auch der britischen Wissenschafterin Mary Kaldor hervorgehoben wird, ist deren unpolitischer Charakter, genau genommen der Verzicht auf eine klassische politische Theorie. Vielmehr wird, auch in einer globalisierten Welt, nach Kaldor eine „Politik der Identität“ verfolgt.
Diese baut in der politischen Mobilisierung auf ethnische und religiöse Linien auf. Verstärkt wird dieser Prozess durch den Zerfall der zentralistischen und autoritären Staatsführung, wie zum Beispiel durch den Kollaps der realsozialistischen Staaten (Jugoslawien) oder von postkolonialen Staaten in Afrika (Somalia) und Asien (Afghanistan). Diese Form der Politik relativiert alte politische Schemata wie links und rechts, fortschrittlich und reaktionär und ersetzt diese durch partikularistische Ausschlusspolitiken. Ein Bekenntnis zu politischen Ideen oder Ideologien ist in diesen Fällen nicht mehr gefragt.
Damit lassen sich nach Münkler als Unterscheidungsmerkmale der „Neuen Kriege“ zu klassischen zwischenstaatlichen Kriegen und „nicht-staatlichen bewaffneten Konflikten“ drei Bereiche identifizieren:
- Entstaatlichung oder Reprivatisierung der Gewalt und der Gewaltakteure;
- unpolitischer Charakter der handlungsanleitenden Motive bei den Kriegsakteuren;
- zunehmende Barbarisierung der Gewaltpraktiken.
Herfried Münkler zieht in seiner Argumentation für die „Neuen Kriege“ eine Parallele zum Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648). So war die Gewaltanwendung in dieser Periode nicht ausschließlich gegen gegnerische Soldaten, sondern auch im großen Umfang gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Kontributionen (Beiträge zum Unterhalt des Heeres), vor allem aber Plünderungen und Brandschatzungen standen an der Tagesordnung, um die Besoldung und Verpflegung der aufgebotenen Soldaten sicherzustellen.
Auch wenn es im Laufe des Krieges immer wieder zu Schlachten kam, so brachte keine eine militärische Entscheidung. Damit verschob sich die Strategie der beteiligten Parteien, weg von einer militärischen Niederlage, hin zur wirtschaftlichen Erschöpfung. Die Kriegsführung war daher von Verwüstungsfeldzügen, kleineren Scharmützeln und Gefechten sowie von Plünderungen und Brandschatzungen gekennzeichnet.
Diese Strategie lässt sich auch bei vielen „Neuen Kriegen“ erkennen. In den meisten Fällen wird weniger die Entscheidungsschlacht im Sinne von Clausewitz gesucht, also die Konzentration militärischer Kräfte, um den Sieg zu erzwingen, sondern vielmehr die Dislozierung der Kräfte in Zeit und Raum. Das bedeutet auch, dass der Krieg in manchen Phasen nicht mehr zu identifizieren ist, da zeitweise kaum Kampfhandlungen stattfinden, diese dann aber plötzlich und mit ungeheurer Intensität wieder aufflammen.
Wesentliche Akteure des Dreißigjährigen Krieges waren Kriegsunternehmer und Generäle, die auf eigene Rechnung Soldaten rekrutierten und sich wiederum durch den Krieg finanzierten, sowie auswärtige Mächte, die nach eigenen Interessen und Möglichkeiten in den Krieg eingriffen und intervenierten. Bekannte Vertreter dieser Kriegsunternehmer waren Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, Graf Peter Ernst II. von Mansfeld oder Herzog Christian von Braunschweig-Wolfsbüttel. Ohne fortwährende Intervention auswärtiger Mächte wäre aber auch der Dreißigjährige Krieg, alleine aus wirtschaftlichen Gründen, kaum so lange möglich gewesen, da Plünderungen und Brandschatzungen eine einseitige Form der Aneignung von Werten darstellen, die selber keine Wertschöpfung leisten und es damit zum wirtschaftlichen Kollaps kommt.
Eine ähnliche Gemengelage bei Kriegsunternehmern (Warlords) bzw. bei der Privatisierung des Militärs und bei ausländischen Interventionen (durch nationale - wirtschaftliche - Interessen) ist auch bei den „Neuen Kriegen“ zu erkennen. Auch hier hat sich eine eigene Form der Kriegsökonomie entwickelt. In Abgrenzung zu den Dekolonialisierungskriegen und den innerstaatlichen Konflikten bzw. den klassischen Bürgerkriegen des 20. Jahrhunderts wird die Ökonomisierung der „Neuen Kriege“ auch durch den Umstand verstärkt, dass die Konfliktparteien, seit dem Ende der Blockkonfrontation durch den Wegfall der materiellen und politischen Unterstützung der großen Mächte, ihre Finanzierungsgrundlage autark sicherstellen müssen.
Schlussendlich ist es die lange Dauer der „Neuen Kriege“. Auch wenn intuitiv anderes vermutet wird, so sind klassische Staatenkriege vergleichsweise von ihrer Dauer im statistischen Schnitt gemäß Münkler eher kurz. „Etwa 25 Prozent aller „Neuen Kriege“ dauern länger als 120 Monate, und damit handelt es sich um die längsten Kriege seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges.“ Diese Länge bedingt sich aber auch durch die zuvor genannten Argumente. Eine Strategie, die eher auf Ermattung als auf eine militärische Entscheidung ausgerichtet ist, führt genauso zu einer Verlängerung der Kriegshandlungen wie ein fehlendes Gewaltmonopol des Staates und die damit verbundene Privatisierung der Akteure, die sich durch den Krieg finanzieren. Ein Friedenszustand würde deren wirtschaftliches Ende bedeuten, wodurch sie ein urtümliches Interesse haben, dass der Konflikt nicht endet.
Konsequenzen und Ausblick
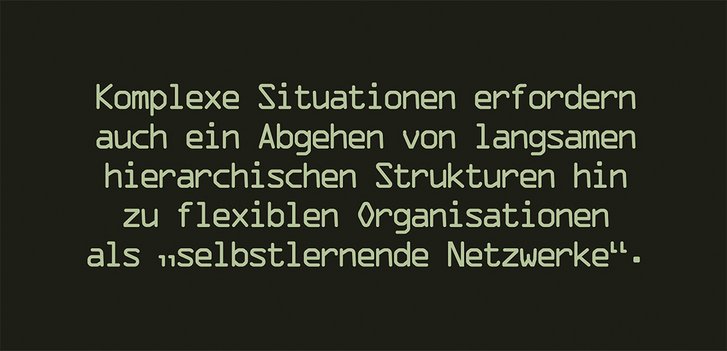
Die Zeiten, in denen die Ausrichtung der Ausbildung und konkreten Einsatzvorbereitung „der Einfachheit halber“ im Szenario auf zwei Konfliktparteien reduziert war, die noch dazu in der Regel offen und klar gekennzeichnet aufgetreten sind, gehören der Vergangenheit an. Einsätze im Umfeld der „Neuen Kriege“ sind nicht einfach, sondern komplex.
Es ist daher notwendig, dass sich die Kräfte des ÖBH in der generellen Einsatzvorbereitung mit derartigen komplexen Szenarien beschäftigen. Ziel dieses Artikels ist es, den Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Auseinandersetzung aufzuzeigen, denn hier können die ersten Ableitungen getroffen werden: Versteht man den Sinn und die Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen, können leichter Gegenmaßnahmen entwickelt werden.
Weiters wurde aufgezeigt, dass die versuchte Einhegung bewaffneter Konflikte auch innerhalb eines Staates durch völkerrechtliche Regelungen, wegen des Auftretens „Neuer Kriege“ wenig wirksam ist, da die hier auftretenden Akteure weder interessiert sind, völkerrechtlich anerkannt zu werden, noch Interesse am raschen Ende der Auseinandersetzung aus finanziellen oder machtpolitischen Überlegungen haben.
In „Neuen Kriegen“ finanzieren sich viele Akteure durch den Konflikt. Ein Friedensschluss würde ihnen die ökonomische Grundlage entziehen. Damit wird eine Stabilisierung in vielen Fällen schwer erreichbar, wenn nicht sogar unmöglich. Gerade diese Erkenntnis zwingt dazu, sich mit der Vielfalt an Akteuren auseinander zu setzen. Desgleichen gilt es, sich deren diffizilen Zielen, aber auch deren Optionen, fliegender Partnerschaften, wechselnder Taktiken und des raschen Gesinnungswandels, zu bedienen - je nachdem, wie gerade die gesteckten Ziele es erfordern.
Das Verständnis hierfür und eine gediegene Analyse der Akteure ist auf allen Führungsebenen erforderlich. Der Soldat der Zukunft muss sich auf allen Führungsebenen in komplexen Szenarien zurechtfinden. Komplexe Situationen erfordern auch ein Abgehen von langsamen hierarchischen Strukturen hin zu flexiblen Organisationen als „selbstlernende Netzwerke“, die horizontal und vertikal übergreifend vernetzt rasch Entscheidungen treffen - nämlich dort, wo sie anfallen - und danach handeln können.
Das Ziel muss es sein, bereits in Vorfeldanalysen aufkommende Probleme zu erkennen - hierfür gilt es, Indikatoren zu definieren - und Konflikte zu lösen, bevor sie ausbrechen und eskalieren. Nur ein stabiles und sicheres Umfeld Europas, respektive Österreichs, gibt auch Sicherheit in der Heimat. Letztendlich trägt das Bundesheer durch seine Auslandseinsätze zur Stabilisierung im Umfeld und somit zur Sicherheit in Österreich massiv bei.
Der Teil 3 dieser Serie wird sich deshalb mit den Akteuren in derartigen Konflikten näher auseinandersetzen, zusätzlich erforderliche Ableitungen treffen und einen Ausblick auf weitere neue Formen der Auseinandersetzungen geben.
wird fortgesetzt...
Teil 1, Teil 3 und Teil 4 der Serie
Oberst Bernhard Schulyok, MA arbeitet in der Abteilung Militärstrategie im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport. Milizfunktion: Kommandant des Jägerbataillons Wien 2 „Maria Theresia“.
Oberstabswachtmeister Lukas Bittner, BA, MA ist in der Abteilung Verteidigungspolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport beschäftigt. Milizfunktion: S3-Bearbeiter beim Jägerbataillon Wien 2 „Maria Theresia“.