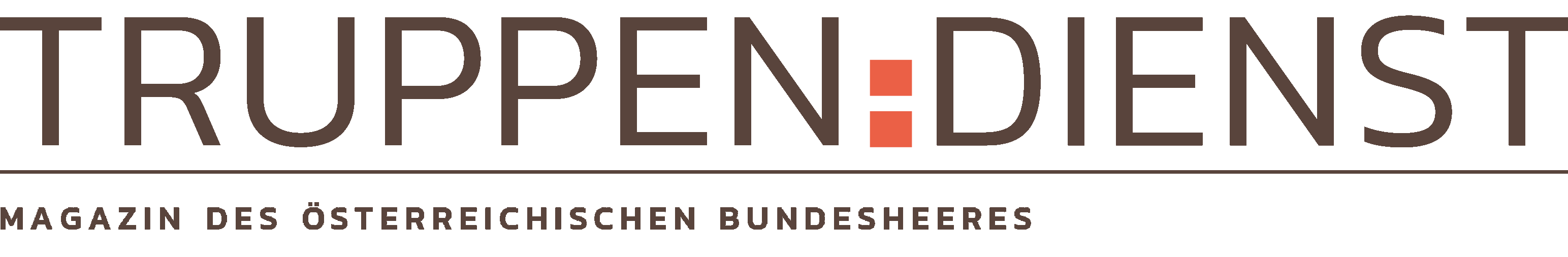Im Schatten der Atombombe

Militärische Revolutionen, oft ausgelöst durch technologische Neuerungen, führten bereits in der Frühzeit zu Änderungen in der Kriegsführung. Die Entwicklung der Atombombe ist ein Beispiel für diese Prozesse.
Teil 1 der Serie: Kriegsführung seit 1945
Die einzelnen Stationen militärischer Revolutionen sind im Hinblick auf die Geschichte klar definierbar: Die frühgeschichtlichen Armeen, meist nicht mehr als undisziplinierte Horden, wurden im antiken Griechenland, vor allem aber im Römischen Reich, durch organisierte und schwergepanzerte Infanterieeinheiten ersetzt. Diese behielten dank ihres harten Trainings und ihrer hohen Moral bis zum frühen Mittelalter eine führende Rolle auf den Schlachtfeldern. Abgelöst wurden die römischen Legionäre durch die schwer gepanzerten Ritterheere des feudalen Europas, die wiederum im 15. Jahrhundert mit der Erfindung des Schießpulvers ein Ende gefunden haben.
Mit dem Ende des Mittelalters kam es die nächsten 400 Jahre zu keiner grundlegenden waffentechnischen Veränderung, erst das 19. Jahrhundert stellte einen echten militärhistorischen Meilenstein dar. Die industrielle Revolution und die verstärkte Mechanisierung veränderten nicht nur den zivilen, sondern auch den militärischen Sektor. Dadurch mussten auch die Regeln der Kriegsführung umgeschrieben werden. Das Aufkommen des Maschinengewehres, der Panzer- und Luftfahrzeuge drängten die bis dahin vorhandene „Ritterlichkeit“ für immer in den Abgrund, der Krieg wurde immer gesichtsloser.
Der Kampf „Mensch gegen Maschine“ forderte schließlich in den beiden Weltkriegen einen bis dahin nie gesehenen Blutzoll. Nach 1945 wurde die Kriegsführung, auch wegen der Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung, wieder konventioneller. Dies bedeutete jedoch keine militärische Rückentwicklung. Das Ziel war und ist weiterhin, dem Feind große Verluste zuzufügen und die eigenen Ausfälle minimal zu halten. Die Militärdoktrin im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wird aktuell vom „integrierten Krieg“ aus dem späten 20. Jahrhundert dominiert.
Dieser sieht eine kombinierte Luft-Boden Operation vor. Das System nutzt die Vorteile der Computer-Revolution und basiert auf dem Einsatz von hochmodernen „intelligenten“ Waffensystemen. Die Schlachten unserer Zeit müssen allerdings an zwei Fronten ausgetragen werden – dem Schlachtfeld und der Cyberfront. Dementsprechend gewinnt neben den Bomben der Besitz von Informationen immer mehr an Bedeutung. Der „Informationskrieg“ öffnet dadurch eine wichtige Front im virtuellen Raum. Generell gilt: Wer schneller an die Information kommt und diese richtig einzusetzen versteht, gewinnt.
Stellvertreterkriege im Schatten des Atomkrieges
Mit dem atomaren Angriff auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki gegen Ende des Zweiten Weltkrieges begann das Atomzeitalter. Zum ersten Mal in der Geschichte verursachte eine einzige Waffe den Tod von etwa 210.000 Menschen auf einen Schlag.
Die Tatsache, dass für diesen enormen Verlust an Menschenleben eine einzige Bombe verantwortlich war, ließ das Massenvernichtungspotenzial von Atomwaffen in den Mittelpunkt der Kriegsführung rücken. In militärischen Fachkreisen stellte sich die Frage, wie die Kriege der Zukunft nach dieser atomaren Erfahrung aussehen werden und ob die konventionelle Kriegsführung als veraltet angesehen werden soll oder nicht.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ließen sowohl die USA als auch die Sowjetunion den überwiegenden Teil ihrer Truppen demobilisieren und die Armeestärke auf das Minimale reduzieren. In Alarmbereitschaft blieben nur die für einen nuklearen Schlag bestimmten Einheiten, im Vergleich zu aktuellen Truppenständen von Armeen war der Personalstand dennoch hoch. Die Amerikaner setzten neben ihren Kernwaffen auf die Luftwaffe, die Sowjets hingegen auf ihre Panzertruppen.
Beide Seiten waren mit den Vorbereitungen für einen möglichen Atomkrieg beschäftigt. Das war der entscheidende Punkt im strategischen Denkmodell der Militärtheoretiker: Rasch wurde erkannt, dass ein atomarer Angriff aus zivilisatorischer Sicht verhängnisvoll wäre. Aus Angst vor einer totalen Vernichtung wurde demnach für die Beibehaltung des bisherigen Charakters des Krieges plädiert; die Kernwaffen sollten in erster Linie lediglich der Abschreckung dienen.
Dass die Rivalität zwischen den beiden Supermächten zu keinem offenen Zusammenstoß führte und der Krieg „kalt“ blieb, bedeutete jedoch nicht, dass die USA beziehungsweise die Sowjetunion den jeweiligen Gegner nicht mit jedem Mittel bekämpfe. Der Kalte Krieg war nicht bloß das Gegenüberstehen zweier Staaten, vielmehr zeigte sich diese Bipolarität in der Ideologie der Kontrahenten, die Machtblöcke von Staaten waren. Überall auf der Welt, wo die Sowjets ihren Einfluss auszudehnen versuchten, stellten sich die USA dieser Machterweiterung entgegen.
Der Kalte Krieg verwandelte sich schrittweise in eine Reihe von „heißen“ Stellvertreterkriegen. Beide Supermächte nutzen diese, um ihr Waffenpotenzial sowie ihre Strategie zu testen, indem sie eine der kämpfenden Seiten in ihren Schutz nahmen, so etwa in Korea, Vietnam oder in Afghanistan. Diese Kriege waren, um die Ausweitung der Gewalt und den Einsatz von Atomwaffen zu vereiteln, territorial begrenzt. Der Begriff „lokaler Krieg“ gewann an Bedeutung.
Charakteristisch für die lokalen Kriege war unter anderem die Verlagerung der symmetrischen Kriegsführung auf eine asymmetrische Ebene. Das bedeutete, dass die militärisch schwache Kriegspartei, oft Rebellen oder Aufständische beziehungsweise Guerilla, die offene Konfrontation mit den regulären Truppen vermieden. Stattdessen kämpften sie in Form von Überfällen und Attentaten, bis das feindliche Hinterland die ersten Zeichen von Kriegsmüdigkeit zeigte.
Einer dieser Stellvertreterkriege, der allerdings noch nicht ganz dem Muster des lokalen Krieges entsprach, spielte sich in den Jahren 1950-1953 auf der koreanischen Halbinsel ab. Das von der Sowjetunion und China unterstützte nordkoreanische Regime fiel in Südkorea ein, das wiederum unter dem Schutz der Amerikaner stand. Nach drei Jahren Blutvergießen wurde ein Waffenstillstand ohne nennenswerte Gebietsänderungen vereinbart. Den USA gelang es, den Vormarsch der Kommunisten und die Ausweitung der Gewalt trotz des chinesischen Kriegseintrittes auf der Seite Nordkoreas aufzuhalten. Im Gegensatz zum lokalen Krieg, blieb in Korea die Symmetrie in der Kriegsführung zunächst erhalten.
Beide Seiten schickten reguläre Truppen in den Kampf, die im Stil des Ersten Weltkrieges entlang klarer Frontlinien gegeneinander kämpften. Vor allem die Kommunisten bauten auf pure Menschenkraft und starteten zahlreiche Massenangriffe. Partisanen- beziehungsweise Guerilla-Aktivitäten waren im Koreakrieg hingegen unbekannt.
„Search and Destroy“ – Die verfehlte Partisanenbekämpfung
Guerilla im großen Stil tauchten erstmals während der napoleonischen Kriege unter anderem in Spanien (1808-1813) auf. Der Begriff bezeichnete Aufständische, die gegen die französischen Besatzer einen „kleinen Krieg“ führten. Solche Einheiten waren schwach bewaffnet, auch fehlte es ihnen an einer militärischen Ausbildung, so dass sie eine offene Schlacht vermieden.
Im Zweiten Weltkrieg leisteten Guerilla-Einheiten, nun Partisanen genannt, in Jugoslawien und Osteuropa hartnäckigen Widerstand und konnten etliche militärische Erfolge gegen die deutschen Okkupanten verzeichnen. Nach 1945 wurde das Potenzial der Guerilla anfangs nicht erkannt. Im Jahr 1948 begannen lokale Partisanen in Malaysia ihren Kampf gegen die britische Besatzung, indem sie zahlreiche Überfälle durchführten. Die Briten erkannten die Gefahr und reagierten unverzüglich. Ihnen war bewusst, dass die Partisanen die Loslösung Malaysias vom britischen Empire anstreben und mit der Propagierung der Unabhängigkeit eine Basis in der Zivilbevölkerung zu schaffen versuchten.
Die Unterstützung durch die Bevölkerung ist für Partisanenbewegungen von existenzieller Bedeutung. Die Briten machten daraufhin klar, dass sie aus Malaysia abziehen und das Land in die Unabhängigkeit entlassen. Mit diesem Schachzug wurde die lebenswichtige Verbindung zwischen der Zivilbevölkerung und den Aufständischen unterbrochen. Die Partisanen wurden so isoliert und von den britischen Einheiten aufgerieben.
Die britische Besatzungsmacht zeigte sich effizient, das „Rezept“ für die Partisanenbekämpfung stieß allerdings in Indochina, bestehend aus Vietnam, Laos und Kambodscha auf Ablehnung. Die Franzosen waren bemüht, die Herrschaft über diese Länder erneut an sich zu reißen und die örtlichen Partisanen zu bekämpfen.
Eine besonders heikle Lage entstand in Vietnam, wo die kommunistischen Partisanen, die „Viet Minh“, immer breitere Schichten der Bevölkerung für sich gewinnen konnten. Die Franzosen antworteten mit der Teilung Vietnams in eine nördliche und südliche Zone, woraus das kommunistische Nordvietnam und das weiterhin unter französischer Herrschaft stehende Südvietnam entstanden. Die „Viet Minh“ blieb im Süden weiterhin aktiv und fügte den Franzosen im Jahre 1954 bei Dien-Bien-Phu eine schwere Niederlage zu. Der Misserfolg weckte auch das Interesse der USA.
Für sie stellte Vietnam ein zweites Korea dar, wo sie den Vormarsch der Kommunisten stoppen wollten. Ab 1961 waren in Südvietnam über 25.000 US-Soldaten präsent, deren Zahl im Jahr 1964 auf 120.000 und ein Jahr später auf 400.000 stieg. Bis Kriegsende (1973) dienten über 2,5 Millionen Soldaten in Vietnam. Die USA maßen, ähnlich wie Frankreich, den Erfolg an der Zahl der getöteten Gegner – dem Body-Count. Das Hauptziel war es, den Feind zu finden und zu eliminieren, nicht aber Gebiete zu kontrollieren. In der Folge genossen die nun „Viet Cong“ genannten Partisanen absolute Bewegungsfreiheit und erhielten von Nordvietnam aus Nachschub. Nach ihren Überfällen konnten sie sich in das benachbarte Laos oder Kambodscha zurückziehen.
Denn die Amerikaner wagten im Namen des „lokalen Krieges“ lange nicht, diese Nachbarländer zu bombardieren, um den Konflikt territorial begrenzt zu halten. Trotz enormer Verluste zeigten die Vietnamesen keine Anzeichen von Kriegsmüdigkeit. Auf der anderen Seite fielen fast 60.000 US-Soldaten in neun Jahren Krieg, ohne Chance auf einen schnellen Sieg. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurden 1973 die letzten US-Truppen abgezogen, zwei Jahre später fiel das alleingelassene Südvietnam an die Kommunisten. Das Desaster der Amerikaner wurde von der Sowjetunion mit großer Befriedigung aufgenommen, bevor es ab 1979 in Afghanistan zu einem Rollentausch kam.
Die sowjetische Intervention in Afghanistan
In Afghanistan übte eine kommunistische Volkspartei die Macht aus, die in dem konservativen Land eine Reihe von Reformen durchführen wollte. Die Bevölkerung reagierte darauf mit derart starkem Widerstand, dass in Afghanistan bald bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. Um die Entmachtung ihres Schützlings zu verhindern, griff die Sowjetunion ab 1979 militärisch ein und besetzte das Land.
Die örtlichen Partisanen, die Mudschahedin oder Gotteskrieger, erklärten daraufhin den heiligen Krieg (Dschihad). Sie zogen sich in die Berge zurück, wo sie von den Sowjets nur schwer erreicht werden konnten. Die sowjetische Intervention in Afghanistan war in vieler Hinsicht ein Spiegel des US-Desasters in Vietnam. Beide Supermächte griffen ein Land an, das sie nicht kannten und dessen Bevölkerung sie mit einer falschen Strategie zu bezwingen versuchten.
So wie die Amerikaner, setzten auch die Sowjets auf die Zahl der getöteten Aufständischen. Ohne Rücksicht auf zivile Opfer bombardierte ihre Luftwaffe Dörfer, in denen Partisanen vermutet wurden. In der Folge genossen die erstarkten Mudschahedin die breite Unterstützung der Zivilbevölkerung und fanden in den benachbarten Ländern Zuflucht und Unterschlupf. Die Sowjetunion war allerdings an einer Ausweitung des Konflikts nicht interessiert, sodass Pakistan und der Iran von Bombenangriffen verschont blieben. Die USA sahen Afghanistan als den nächsten Schauplatz des Kalten Krieges an und sagten den Aufständischen materielle sowie finanzielle Hilfe zu.
In Pakistan agierte darüber hinaus ein dichtes Netz der CIA mit dem Ziel, die Mudschahedin auszubilden und mit modernen Waffensystemen zu versorgen. Die amerikanischen Waffen zeigten rasch ihre Wirkung. Die sowjetischen Truppen steckten in den Städten fest, da sie die Kontrolle über die Provinz nach und nach verloren hatten. Die Patt-Situation endete erst im Jahre 1989 mit dem Abzug der letzten sowjetischen Truppen aus Afghanistan, damit war die Niederlage einer weiteren Supermacht besiegelt.
Gabor Orban, BA absolviert ein Masterstudium an der Universität Wien.