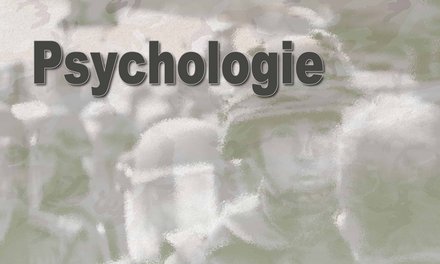- Veröffentlichungsdatum : 11.09.2023
- – Letztes Update : 29.09.2023
- 9 Min -
- 1890 Wörter
- - 3 Bilder
Offiziersausbildung vor 50 Jahren
Der Jahrgang Starhemberg 1683 in 50 Fragen und Antworten

Der Jahrgang Starhemberg 1683 war der (bis heute) dienstrechtlich, herkunfts- und altersmäßig inhomogenste Militärakademiker-Jahrgang des Bundesheeres der Zweiten Republik. Anlässlich des „Fünfzigers“ des Jahrganges zeigt TRUPPENDIENST in 50 Fragen und Antworten Aspekte der damaligen Offiziersausbildung. Das ermöglicht einen Einblick in das Geschehen an der Theresianischen Militärakademie vor einem halben Jahrhundert sowie einen Vergleich mit nachfolgenden Studienordnungen und deren Ausbildungszielen bis zur Gegenwart. Obwohl sich die Landesverteidigung damals an einem Tiefpunkt befand und sich der Andrang zum Offiziersberuf in Grenzen hielt, setzte die Theresianische Militärakademie auf Leistung und eine solide, weit gefächerte militärische Ausbildung.
Die Entscheidung der Angehörigen des Jahrgangs Starhemberg 1683 für den Offiziersberuf und deren Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie erfolgte in einer Ära, in der
- ein Teil der Bevölkerung die Auflösung des Bundesheeres „begehrte“ (1969/70 warb der SPÖ-Abgeordnete DDr. Günther Nenning unterstützt durch den ÖVP-nahen Pazifisten Univ. Prof. Dr. Wilfried Daim, den Publizisten Gerhard Oberschlik und anderen um Unterschriften zur Einleitung eines „Anti-Bundesheer-Volksbegehrens“),
- der Kalte Krieg voll im Gange war und dennoch friedensbewegte Intellektuelle sowie Pazifisten eine Bühne hatten,
- viele Österreicher vom Bundesheer enttäuscht waren und sich von diesem im Stich gelassen fühlten, hatte es sich doch während der „Tschechenkrise“ 1968 von der Grenze zurückgezogen,
- eine erfolgreiche Gegenwehr eines Kleinstaates gegen die Truppen des Warschauer Paktes kaum möglich schien und
- es (vermutlich deshalb) einen „Sechs Monate sind genug“-Wahlkampf gab (die Wehrdienstzeit betrug von 1956 bis 1971 neun und ab 1971 acht Monate).
Das Österreichische Bundesheer befand sich damals an einem Tiefpunkt. Weil 1969/70 eine Wende zum Besseren nicht absehbar war, hielt sich der Andrang zum Offiziersberuf in Grenzen. Dennoch senkte die Theresianische Militärakademie weder die Auswahlkriterien noch erleichterte oder verkürzte sie die Offiziersausbildung.
Eine ähnliche Situation dürfte Starhemberg 1683 vorgefunden und in dieser als Offizier treu und unbeirrt seine Pflicht erfüllt haben, obwohl er sich in einer relativ schlechten Position befand: Der Kaiser hatte Wien verlassen, die Stadtmauern waren zum Teil in einem erbärmlichen Zustand, die Stadt verfügte nur über einige Tausend „echte“ Soldaten (der Rest waren Bürgerwehren), die militärische Übermacht der Osmanen war enorm und ein Entsatz im Falle eines Angriffs auf Wien (der tatsächlich stattfand) keineswegs sicher. Die Anwärter auf den Offiziersberuf wähnten sich 1969/70, am damaligen Tiefpunkt der Landesverteidigung, in einer ähnlichen Situation. Sie waren – wie Starhemberg 1683 – bereit, auch in dieser relativ schlechten Position ihre militärischen Pflichten zu erfüllen und sich weder durch den Mangel an Waffen (vor allem Panzerabwehr- und Fliegerabwehrlenkwaffen), Gerät und Infrastruktur noch durch einen „scheinbar übermächtigen Gegner“ davon abhalten zu lassen.
Die Theresianische Militärakademie setzte mit der (noch in Trimester unterteilten) Studienordnung 70 trotz aller Widrigkeiten weiterhin auf Leistung, Einsatztauglichkeit sowie auf eine fordernde, weit gefächerte militärische und gesellschaftspolitische Ausbildung. Der Jahrgang Starhemberg 1683 wurde darauf vorbereitet, falls erforderlich, überlegt „in eine Gefahr hinein“ zu handeln, aber auch darauf, ohne hohes Sozialprestige und, für einen im Vergleich zu anderen Berufen niedrigen Gehalt, Unbill wie lange Dienstzeiten, widrige Witterungsbedingungen, unklare Lage, Stress, Mehrbelastung, Schlafentzug, Hunger und Kälte usw. zu ertragen. Jahre später prägten zwei Psychologinnen für genau diese Eigenschaften die Begriffe Hardiness und Resilienz (Suzanne C. Kobasa 1979 „Hardiness“ für Widerstandsfähigkeit bei Stress sowie in kritischen Situationen und Emmy E. Werner 1982 „Resilience“, für die Fähigkeit, Belastungssituationen zu bewältigen).
Es zeigte sich, dass Soldaten, die über diese Eigenschaften verfügen, sowohl im täglichen Dienst wie auch im Einsatz meist verlässlich und erfolgreich sind – oft sogar erfolgreicher als „Helden“, tollkühne Draufgänger, Intellektuelle oder Manager. Hier ist anzumerken, dass „kampfgeile Waffennarren“ spätestens nach der mehrtägigen psychologischen Testung im Auswahlkurs aus der Militärakademie flogen. Diese Hardiness und Resilienz sowie die dazugehörige Ausbildung sind heute wahrscheinlich mindestens so wichtig wie Akademisierung, Informationstechnologie, körperliche Fitness, der Humanität verpflichtete Führungsqualitäten, Beherrschen der Waffensysteme und taktisches Geschick.
50 Fragen und Antworten zum Jahrgang Starhemberg 1683
Zur leichteren Übersicht und auf Grund der Länge sind die 50 Fragen und Antworten in fünf Artikel zu je 10 Fragen und Antworten aufgeteilt. Diese können über den Link (Überschrift) aufgerufen werden.
Teil 1 (Fragen 1 bis 10)
1. Wie war die Offiziersausbildung vor 50 Jahren aufgebaut und was waren ihre Ziele?
2. Was waren die damaligen „Eintrittskarten“ zur dreijährigen Offiziersausbildung?
3. Wozu diente der Auswahlkurs?
4. Woher stammten die Militärakademiker, die die Ausbildung zum Offizier schafften, wie viele haben sich beworben und wie hoch war die Ausfallsrate?
5. Welches Organisationselement war für den Jahrgang Starhemberg 1683 zuständig und wer leitete diesen?
6. Gab es vor 50 Jahren Militärakademiker mit Migrationshintergrund bzw. Frauen im Jahrgang?
7. Welchen akademischen Grad erwarben die Militärakademiker durch ihr Studium?
8. In welchem wehr- und sicherheitspolitischen Umfeld erfolgte damals die Offiziersausbildung?
9. Wann und warum wurde Starhemberg 1683 als Name gewählt?
10. Gab bzw. gibt es Berührungspunkte zu Starhemberg, z.B. zum heute noch existierenden Adelsgeschlecht dieses Namens?
Teil 2 (Fragen 11 bis 20)
11. Wurde der Jahrgang Starhemberg 1683 mit dem Briefbomber Franz Fuchs (auf Grund dessen Signaturfloskel „Wir wehren uns! Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg“) in Verbindung gebracht?
12. Was wurde ausgebildet und wer hat ausgebildet?
13. Wie zeitintensiv war die Ausbildung und wie hoch die zeitliche Inanspruchnahme?
14. Auf welche Eigenschaften und Fähigkeiten legte die Militärakademie damals besonderen Wert?
15. Wie sah es damals mit technischen Hilfsmitteln bzw. Ausbildungshilfsmitteln aus?
16. Viele Ausbildungsgänge finden „in einem Elfenbeinturm“ statt, wie war das damals an der Militärakademie?
17. An welchen Waffen und Kampfmitteln wurden die Militärakademiker ausgebildet?
18. An welchen Fahrzeugen wurden die Militärakademiker ausgebildet?
19. Welchen Stellenwert hatte und wie erfolgte die Körperausbildung?
20. War die Ausbildung gefährlich?
Teil 3 (Fragen 21 bis 30)
21. Wurde in der Offiziersausbildung großer Wert auf gefechtsmäßiges Verhalten (Tarnung, Bewegungsarten usw.) gelegt?
22. Wie sah es mit Fremdsprachen aus und gab es eine Ausbildung für Auslandseinsätze?
23. Wo wurde ausgebildet und wo wurde geübt?
24. Gab es auch Hausübungen?
25. Wie erfolgte die Ausbildung der künftigen Offiziere zum Kommandanten?
26. Wie erfolgte die Ausbildung der künftigen Offiziere zum Ausbilder/Lehrer?
27. Wie erfolgte die Ausbildung der künftigen Offiziere zum Verwalter?
28. Gab es für die Tätigkeit als Kommandant und Ausbilder/Lehrer eine spezielle Ausbildung in Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit?
29. Haben sich in den letzten 50 Jahren Lehrmeinungen und Ausbildungsschwergewichte geändert?
30. Wie sahen die Militärakademiker ihre künftige Funktion bzw. ihr Selbstverständnis als österreichischer Offizier?
Teil 4 (Fragen 31 bis 40)
31. Wie hielt es der Jahrgang Starhemberg 1683 mit der Neutralität?
32. Wer war damals „der Feind“?
33. Wie gestaltete sich die Kameradschaft innerhalb des Jahrganges?
34. Wie war die Unterbringung?
35. Wie war die Verpflegung?
36. Gab es Akademieuniformen wie an anderen Militärakademien?
37. Welchen Dienstgrad hatte man damals an der Militärakademie und was verdiente man als Militärakademiker?
38. Ging es laut zu, wurde viel geschrien?
39. Gab es Anzipf und Schleiferei?
40. Durfte man ins Ausland fahren, musste man z.B. vor einer Heirat um Erlaubnis fragen usw.?
Teil 5 (Fragen 41 bis 50)
41. Gab es Regeln und Vorschriften für das persönliche Aussehen bzw. Auftreten?
42. Wie sah es im Jahrgang mit Ordnung und Disziplin aus und (wie) wurde Fehlverhalten bestraft?
43. Gab es viel Drill und/oder Leerlauf?
44. Wann bzw. warum musste jemand den Jahrgang verlassen? Durfte man diesen dann wiederholen?
45. Gab es Kontakte zu ausländischen Militärakademien?
46. Lernte man damals als Militärakademiker auch tanzen und eröffneten Militärakademiker tatsächlich jedes Jahr den Opernball?
47. Wie erfolgte die Ausbildung an den Waffenschulen im Dritten Jahrgang und wie lief die Sonderausbildung der Piloten ab?
48. Wie wurde die Offiziersausbildung vor 50 Jahren vom Ausland eingeschätzt?
49. Wie erfolgte damals die Ausmusterung?
50. Wer hat die Ausbildung geschafft, was wurde aus diesen Personen und in welchen Bereichen haben sie das Bundesheer der nächsten Jahrzehnte mitgestaltet?
Auf einen Blick
Der Jahrgang Starhemberg 1683 hat die Erwartungen der Militärakademie sowie des Bundesheeres erfüllt und fallweise sogar übertroffen. Viele berufliche Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche der Jahrgangsteilnehmer gingen in Erfüllung. Das zeigen u.a. die in der Frage 50 dargestellten Leistungen.
Die Offiziere des Ausmusterungsjahrganges 1973 verfügten über psychisches und physisches Stehvermögen (ein Angehöriger des Jahrganges war während seiner jahrzehntelangen Dienstzeit als Offizier keinen einzigen Tag im Krankenstand) sowie fallweise über eine „Elefantenhaut“, die sie u.a. dazu befähigte trotz Anwürfen und öffentlichen Untergriffen zu bestehen. Sie konnten die Ära der Raumverteidigung und die Jahre danach aktiv mitgestalten und teilweise sogar prägen – egal ob im Bereich der Einsatzvorbereitung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Luftraumüberwachung, der Grenzsicherung oder in anderen Bereichen. Es handelte sich um die Ära, in der die Soldaten des Bundesheeres
- als „Bürger in Uniform“ in der Bevölkerung besser verankert waren als je zuvor,
- einen personellen Höchststand von 186 000 Mann erreichten (für die Ausrüstung und Bewaffnung vorhanden war, mit Logistik- und Ersatztruppen sogar weit über 200 000) und
- im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung für die gewünschte/geforderte Abhaltung sorgten (was von ehemaligen Offizieren des Warschauer Paktes bestätigt wurde).
Vieles hat sich in der Zwischenzeit auch in der Offiziersausbildung geändert. Österreich liegt nicht mehr zwischen zwei Machtblöcken. Die Offiziere erhalten nach der Ausmusterung einen mit anderen staatlichen Funktionen vergleichbaren Gehalt (wenngleich sie als „Maturanten“ und nicht als „Akademiker“ eingestuft sind). Diesen erhalten sie schon während ihrer, nun offiziell als akademisch anerkannten, Ausbildung, deren Ziel die meisten Fähnriche in der Mindeststudiendauer erreichen. Globalisierung, Internationalisierung, Informationstechnologie, Akademisierung, Managerdenken sowie das Wehrrecht für Frauen beeinflussen auch das neue Offiziersbild sowie die aktuelle Ausbildung.
Aber es gibt auch Wermutstropfen:
- Das österreichische Verteidigungsbudget (1970 ca. 1,1 Prozent, 2022 ca. 0,77 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) ist anteilsmäßig niedriger als vor 50 Jahren.
- Die Wehrdienstzeit beträgt aus parteipolitischen (militärisch jedoch kaum nachvollziehbaren) Gründen nur mehr sechs Monate. Die Miliz wurde (im Vergleich zur Ära der Raumverteidigung) auf Grund der Aussetzung der Übungspflicht marginalisiert.
- Der Tauglichkeitsgrad, der vor 50 Jahren (ca. 48 000 Stellungspflichtige) bei ca. 90 Prozent lag, liegt derzeit (ca. 38 000 Stellungspflichtige einschließlich Zivildienern) nur mehr bei ca. 74 Prozent. Der Anteil an Zivildienern liegt zwischen 40 und 45 Prozent der Tauglichen. All das reduziert die Anzahl und den Ausbildungsstand der in einem Ernstfall verfügbaren Soldaten.
- Während in den letzten Jahrzehnten die Interventionsfähigkeit und -bereitschaft anderer Staaten stieg (u.a. ersichtlich an den geradezu explodierenden Wehrbudgets von China und Russland) wurde die Fähigkeit des Bundesheeres zur militärischen Landesverteidigung über zwei Jahrzehnte lang herabgesetzt, nicht wenige Meinungsbilder unterstellen dem (ohnedies seit Jahrzehnten von Reform zu Reform taumelnden) Bundesheer dennoch einen Reformunwillen.
- Mit Ausnahme der Klimakrise und Pandemien redeten und reden Meinungsführer reale Bedrohungen (Migration, Expansionsbestrebungen totalitärer Staaten, Terror etc.) klein bzw. negieren oder leugnen sie sogar fallweise.
- Das in den letzten Jahrzehnten zur Kosten- und Personaleinsparung praktizierte „Outsourcing“ (u.a. in den Bereichen Instandsetzung, Lagerhaltung, Energieversorgung, Verpflegung aber auch bei Dienstleistungen) hat zu Kompetenzverlusten und Abhängigkeiten geführt, die vor allem in Krisenzeiten die Handlungsunfähigkeit von Verbänden einschränken können.
- Die politisch und militärisch Verantwortlichen mussten erkennen, dass ein demokratisch orientiertes Europa „am Hindukusch“ weder nachhaltig geschützt noch erfolgreich verteidigt werden konnte. Dem Traum von einer „kooperativen Sicherheit in Europa“ folgte das unsanfte Erwachen in relativer militärischer Schwäche gegenüber potentiellen und realen Bedrohungen.
- Politik und Diplomatie waren nicht in der Lage, den „Eroberungsfeldzug“ Russlands gegen die benachbarte Ukraine zu verhindern. Somit tobt nach drei Jahrzehnten Marginalisierung der Landesverteidigung in mehreren europäischen Staaten (Stichwort Friedensdividende) in Europa wieder ein Angriffskrieg.
Herausforderungen für die künftige Offiziersgeneration gibt es genug. Doch diese wird das Österreichische Bundesheer ebenso mitgestalten und prägen wie der Jahrgang Starhemberg 1683 ein halbes Jahrhundert zuvor. Die Offiziere dieses Jahrganges gehören jedenfalls zur ersten Soldatengeneration Österreichs (die Zeit der Donaumonarchie eingeschlossen), der es vergönnt war, ihr gesamtes militärisches Leben lang keinen Krieg, keinen Einmarsch und keine Besetzung ihres Staates miterleben zu müssen. Der Jahrgang Starhemberg 1683 und TRUPPENDIENST wünschen dies auch den nachfolgenden Offiziersgenerationen.
Autorengemeinschaft Jahrgang Starhemberg 1683