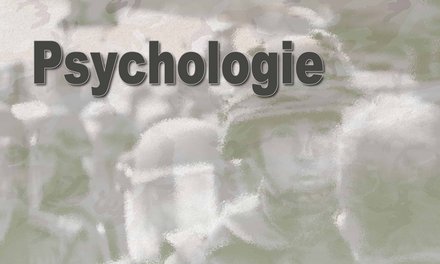Helfen unter härtesten Bedingungen

Bombardierte Hilfskonvois, Operationen in Spitälern, denen es am Nötigsten fehlt, entführte Helferinnen und Helfer. Solche Ereignisse machen immer wieder Schlagzeilen in den Medien. Helfen in Kriegs- und Krisengebieten ist ein harter und gefährlicher Job. Um angehende Mitarbeiter von internationalen Organisationen und NGOs bestmöglich auf diese Arbeit vorzubereiten, pflegen der UNESCO Chair of Peace Studies der Universität Innsbruck und das Militärkommando Tirol seit Jahren eine wertvolle Partnerschaft.
Nur vorsichtig nähert sich ein junges Paar dem Fahrzeug mit der großen, blauen UN-Fahne auf der Motorhaube. Als die Männer mit ihren hellblauen Westen aussteigen, weichen sie vorsichtig wieder zurück, kommen dann aber doch Schritt für Schritt näher. Es entspannt sich ein schleppender Dialog: „Wo sind die anderen Männer?“ – „Welche anderen Männer?“ – „Die im Wald, die bringen alle um.“ – „Wir gehören nicht zu denen. Wir wollen euch helfen. Wir sind von den UN.“ – „Habt ihr Waffen?“ – „Nein, wir sind unbewaffnet. Wir tun euch nichts. Wir helfen den Menschen.“ Als sich ein zweites UN-Fahrzeug der Gruppe nähert, scheint das Paar das inzwischen mühsam aufgebaute Vertrauen wieder ein wenig zu verlieren und weicht neuerlich zurück. Es gelingt den UN-Mitarbeitern aber, das Gespräch fortzusetzen. Schließlich erzählen der junge Mann und die Frau unter Tränen und Schluchzen, dass die Bewaffneten in ihr Dorf gekommen seien und viele ihrer Freunde und Angehörigen getötet hätten. Zum Beweis führen sie die Fremden zu einer Stelle, an der sich ein Massengrab befinden soll. Einer der UN-Mitarbeiter verspricht: „Wir werden die, die das getan haben, vor das Kriegsverbrechertribunal stellen.“
An dieser Stelle merkt Generalmajor Mag. Herbert Bauer, Militärkommandant von Tirol, der als Beobachter anwesend ist, auf. Denn die Macht, den Menschen hier etwas zu versprechen, haben die UN-Mitarbeiter laut Mandat nicht. Im Ernstfall könnte diese Aussage also ein entscheidender Fehler sein und das Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung auf Dauer belasten. Doch die beschriebene Szene spielte sich im Rahmen der „Native Challenge“, einer Übung von „Friedensstudierenden“ mit tatkräftiger Unterstützung des ÖBH auf dem Truppenübungsplatz Lizum/Walchen im Februar 2016 ab. Die Folgen dieser Aussage fanden „nur“ Eingang in die Bewertung des Übungsablaufes.
Seit dem Jahr 2005 findet die Zusammenarbeit zwischen dem Militärkommando Tirol und dem Masterstudiengang Peace, Development, Security and International Conflict Transformation statt. Während dieser Zeit hat das Militärkommando Tirol fast jedes Jahr in eine Winter- und eine Sommerausbildungswoche mit den wechselnden Studierenden aus dutzenden unterschiedlichen Ländern durchgeführt. Die Ausbildung vermittelt theoretische und praktische Aspekte der Friedensarbeit und simuliert das Umfeld eines Krisengebietes im Ausland. Die Studierenden werden dabei in unterschiedlichen Rollen in eine fiktive UN-Fact-Finding-Mission eingebunden, mit den zu erwartenden Situationen in einem Krisengebiet vertraut gemacht und systematisch ausgebildet.
Das „Friedensstudium“
Der Universitätslehrgang für Frieden, Entwicklung und Internationale Konflikttransformation wird als viersemestriges Postgraduate-Master-Studium durch die Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme ist zumindest ein Bachelor-Grad.
Die Studenten können bei der Absolvierung der Semester frei zwischen den Standorten Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, der UN Friedensuniversität Costa Rica und der Universität Jaume I, Castellón (Spanien), wählen. Um den Wechsel zwischen den verschiedenen Orten zu erleichtern, wurde der Lehrgang eigens in Modulen aufgebaut. Die Studieninhalte richten sich hauptsächlich an bereits aktive oder zukünftige Angehörige von NGOs, die in Krisen- und Kriegsgebieten arbeiten.
Aus diesem Umfeld stammt auch der Gründer des Programms und nunmehrige Inhaber des UNESCO Lehrstuhles, Prof. DDr. Wolfgang Dietrich: „Nach mehr als zwei Jahrzehnten Felderfahrung war es mir ein Bedürfnis, ein Programm aufzubauen, um praktische Dinge nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem ganzen Körper zu erlernen und ins akademische Leben einzubauen.“ Seit 2011 entwickelte sich das Programm, nicht zuletzt aufgrund der Kontinuität der akademischen Betreuung und dem großen Praxisansatz zunehmend als einziges ernstzunehmendes Projekt in der internationalen Community, das mit nachhaltigem Erfolg durchgeführt wird. Prof. DDr. Dietrich: „Innsbruck hat das am besten entwickelte Curriculum in diesem Fach weltweit.“
Universitätslehrgang für Frieden, Entwicklung und Internationale Konflikttransformation
Die Durchführung der Übungswochen
Die Ausbildungswochen beim ÖBH finden hauptsächlich auf dem Truppenübungsplatz Lizum/Walchen statt. Je nach Semester werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort in drei Funktionen eingesetzt: im ersten Semester als einfache Teammitglieder, im zweiten als Teamleader, im dritten schließlich in der Stabsarbeit im Hauptquartier der fiktiven Mission. Gemeinsame Sprache ist selbstverständlich ausschließlich Englisch. Vor dem Einstieg in die eigentliche Übung findet eine Unterweisung bzw. Ausbildung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer in folgenden Bereichen statt:
- Hintergrundwissen zur UN-Organisation
- Basisinformationen zu friedenserhaltenden Operationen
- Stabsorganisation und -dienst inkl. Briefingtechniken
- Handhabung von Funkgeräten und Funksprechverkehr
- Zivil-militärische Zusammenarbeit im Einsatzraum
- Einsatzplanung
- Erste Hilfe
- Minenkunde
- Untersuchungsmethoden bei Vorkommnissen
- Verhandlungstechniken
- Verfassen von Einsatz- und Erkundungsberichten
- Einsatzlogistik
Nach diesem teils theoretischen, teils praktischen Teil erfolgt der Einstieg in die unmittelbare Übung, die Durchführung der besagten fiktiven UN-Factfinding-Mission.

Das „Drehbuch“ für die Mission liefern Angehörige des ÖBH. In den letzten Jahren war Oberst Bernd Rott, Kommandant des Jägerbataillons 24, „Regisseur“ all der Aufgaben und Vorfälle, die die Studierenden abzuarbeiten haben. Ausgelassen wird dabei nichts: vom Minenunfall über einen Brand in der Unterkunft bis zur Festnahme und einem Verhör durch die Geheimpolizei des Landes, in dem die Mission stattfindet, reichen die Einspielungen.
Die Roleplayer stellt zum überwiegenden Teil die 6. Jägerbrigade, aber auch ehemalige Absolventinnen und Absolventen des Studiums stellen sich als Ideengeber und Schauspieler zur Verfügung. Als Lehrer und Coaches stehen auslandserfahrene Offiziere und Unteroffiziere des Militärkommandos Tirol und der 6. Jägerbrigade (teilweise auch aus dem Milizstand) bereit. Beim Sommertermin werden die Teams der Mission auch zur Informationsgewinnung und zur Schulung der Verhandlungsführung mit verschiedenen Parteien in ein urbanes Umfeld – konkret nach Hall in Tirol – verlegt.
Behörden und Geschäftsinhaber sind eingeweiht und spielen teilweise ebenfalls mit. Von den Themen her, so weiß GenMjr Mag. Herbert Bauer, ist der Sommertermin anspruchsvoller: „In der Winterwoche kämpfen viele der Studierenden mehr mit den Umständen des winterlichen Hochgebirges.“ Immerhin sind auch junge Menschen dabei, die Berge und Schnee bislang nur von Fotos kannten. Insgesamt werden den Studierenden je nach der bereits beschriebenen Rolle (Teammitglied, Teamleader, Mitarbeiter im HQ) folgende Aufgaben gestellt:
- Errichten und Betreiben eines HQ
- Einsatz von Fieldteams zur Erhebung eines Lagebildes
- Führen von Verhandlungen
- Verlegungen in den urbanen bzw. gebirgigen Raum
- Erfassen der Lage durch Gespräche mit Offiziellen und Bevölkerung (Roleplayer)
- Bewältigen von Zwischenfällen (z. B. Checkpoints, Minen, Medien, Unfall)
- Bearbeiten der Gesprächsergebnisse und Reporting
- Beurteilen der Lage, Plan der Durchführung für Folgeauftrag jew. auf der Ebene HQ und Teamleader
Dies passiert, wie aus den plastischen Beispielen ersichtlich wird, stets sehr realitätsnahe und geistig und teilweise auch körperlich fordernd.
Das Szenario, das dabei um die Studierenden aufgebaut wird, ist mehrschichtig. Einmal wird bereits vor dem Beginn der eigentlichen Übungswoche im Internet eine virtuelle Welt für die Teilnehmer aufgebaut, in der sie Zeitungsausschnitte, Memoranden und andere Informationen zu ihrem Einsatzgebiet sammeln können. Fiktive Medien berichten über den Konflikt im Land, die aktuelle Situation, politische Gegebenheiten.
Diese Medien müssen die Übungsteilnehmer auch während der „Aktivwoche“ immer im Hinterkopf behalten: Was wird über die Mission berichtet und welche Auswirkungen hat das auf deren Arbeit? Schließlich gelangen sie ins tatsächliche Einsatzgebiet und werden vor zahlreiche Probleme gestellt, die tatsächlich auftauchen können:
Was ist zu tun, wenn plötzlich eine große Menge von Flüchtlingen vor der Tür steht? Helfen, obwohl es nicht die Aufgabe der Mission ist und diese unter Umständen sogar gefährden kann? Was tun mit religiösen Anführern, die den Lenkern der angemieteten Fahrzeuge erklären, dass es ihnen verboten ist, für die Ungläubigen zu arbeiten? (Wobei die vorkommenden Religionen frei erfunden sind und sich aus Komponenten zusammensetzen, die keinen Rückschluss auf eine tatsächliche Glaubensrichtung zulassen.) Nach jeder absolvierten Übungseinlage erhalten die Teilnehmer eine Rückmeldung ihrer Coaches. Gegebenenfalls werden auch Inhalte wiederholt.
So hart und gefährlich, wie das, was manche dieser angehenden Helfer in Afghanistan, Syrien, im Sudan oder anderswo erleben werden, kann allerdings auch die beste Ausbildung nicht sein.
Die Synergien für das ÖBH
Der Benefit für das ÖBH liegt einerseits in einer ständigen Verbesserung seiner Kompetenz im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit, auf die bei der Ausbildung mit den Studierenden besonderer Wert gelegt wird. Überdies wird den Studierenden und zukünftigen Mitarbeitern von NGOs oder internationalen oder Regierungsorganisationen ein Grundverständnis für militärische Strukturen und insbesondere von internationalen Streitkräften in UN-Einsätzen vermittelt, welches bei einem realen Aufeinandertreffen der beiden Parteien von großem Vorteil sein kann.
Ein weiterer Nuzten besteht in einer Vernetzung in und mit der akademischen Welt in- und außerhalb eines militärischen Kontextes. Absolventen des Lehrgangs haben auch bereits an internationalen Übungen des Bundesheers teilgenommen und dort ihrerseits das zivile Umfeld für die Truppe simuliert. Und nicht zuletzt haben die Ausbildungswochen mit den Friedensstudenten in den letzten Jahren ein überdurchschnittlich großes und positives mediales Echo hinterlassen.