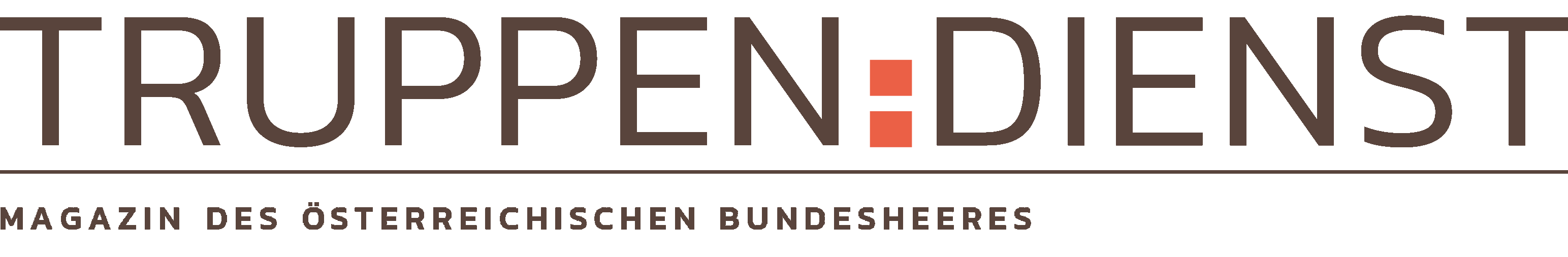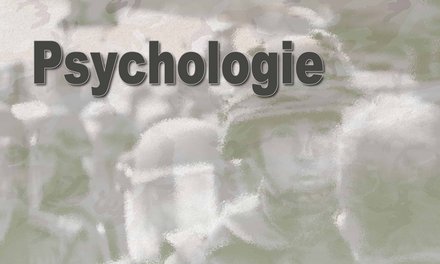- Veröffentlichungsdatum : 08.07.2020
- – Letztes Update : 06.07.2020
- 11 Min -
- 2150 Wörter
- - 6 Bilder
Fachkräftemangel auch im Marinesanitätsdienst

Dass es Probleme beim Sanitätsdienst der Bundeswehr gibt, ist nicht neu. Allem voran fehlen Fachkräfte, um die Soldaten medizinisch umfassend betreuen zu können. Im aktuellen Jahresbericht des Wehrbeauf- tragten kann man nachlesen: 22 Prozent der Facharztstellen sind vakant. Ähnlich sieht es beim Assistenzpersonal aus: In der Zahnmedizin sind die Feldwebeldienstposten lediglich zu 66 Prozent besetzt, im Rettungsdienst zu 77 Prozent. Bei den Unteroffizieren für die ambulante Versorgung liegt die Besetzungsquote bei 64 Prozent. Grund genug, den Admiralarzt der Deutschen Marine, Admiralarzt Dr. Stephan Apel, zu fragen, wie es um den Sanitätsdienst der Marine steht. Das Interview für den TRUPPENDIENST führte Jürgen R. Draxler.
Jürgen R. Draxler: Vorweg eine grundsätzliche Frage: In der Bundeswehr gibt es seit fast 20 Jahren den Zentralen Sanitätsdienst, wozu gibt es dann noch einen Marinesanitätsdienst?
Stephan Apel: Der Marinesanitätsdienst ist, wie die Sanitätsdienste der anderen Teilstreitkräfte – der truppennahe Sanitätsdienst – in die Truppe integriert, um die besonderen Bedürfnisse von Truppenteilen bedienen zu können. Deswegen haben wir den Marinesanitätsdienst an Bord, in den fliegenden Verbänden und in den Spezialkräften. Das heißt immer da, wo es darauf ankommt, ist der Sanitätsdienst Bestandteil des Denkens und der Planung der zu versorgenden Truppenteile. Die Angehörigen des Marinesanitätsdienstes werden ausgebildet, üben und leben zusammen mit „ihrer“ Truppe. Das ist anders als im Zentralen Sanitätsdienst, wo die Hauptbedarfsträger Heer/Land, Streitkräftebasis/Land, Luftwaffe/Boden einheitliche Vorschriften, Verfahrensweisen und Bedürfnisse haben. Sie unterscheiden sich nur in Nuancen. Aber zwischen einem Minensucher und einer Fregatte liegen Welten.
Draxler: Warum sind dann Sanitätssoldaten anderer Teilstreitkräfte in der Marine im Einsatz?
Apel: In der Marine sieht man Sanitätsoffiziere anderer Teilstreitkräfte im Bereich der klinischen Fachärzte – wie Chirurgen oder Anästhesisten – in den Bordfacharztgruppen und in den Rettungszentren See der Einsatzgruppenversorger. Für rein medizinische Aufgaben wie die chirurgische Erstversorgung spielt es keine Rolle, welche Uniform der Arzt trägt. Zudem finden sich diese klinischen Dienstposten zumeist im Zentralen Sanitätsdienst, wo sie den Bundeswehrkrankenhäusern zugeordnet sind. Dennoch bekommen diese Ärzte eine Bordausbildung, um sie mit den Verhältnissen auf den Schiffen vertraut zu machen. Wer dagegen als Schiffsarzt – also integriert in die Truppe – fährt, hat eine einjährige Ausbildung unter Federführung des Schifffahrtsmedizinischen Institutes erhalten, er ist sozusagen „navalisiert“.
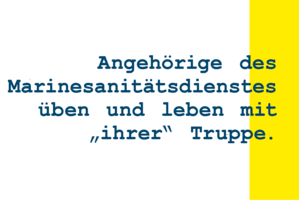
Draxler: Könnten so gesehen auch Sanitätsoffiziere befreundeter, nicht zur See fahrender Nationen an Bord eingesetzt werden?
Apel: Richtig, wir hatten bereits zwei österreichische Heeresärzte an Bord. Das war durchaus erfolgreich.
Draxler: Der Personalmangel der Bundeswehr trifft auch den Sanitätsdienst mit seinen zum Teil sehr langen Ausbildungszeiten. Ist hier eine Trendwende festzustellen?
Apel: Die Trendwende ist tatsächlich da, auf dem Papier erreichen wir fast 100 Prozent des Solls. Aber: Teilzeit, Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeit sorgen im täglichen Dienst für Lücken. Dafür haben wir in der Bundeswehr keine Kompensationsmöglichkeit.
Hierzu ein Beispiel: Eine halbtags tätige Frau Hauptbootsmann (Stabswachtmeister, OR-7; Anm.) will für zwei Jahre in Elternzeit gehen, und eine zweite Soldatin in der Abteilung – ebenfalls mit halber Stelle tätig – möchte das auch. Damit wäre fiskalisch für zwei Jahre eine Stelle frei. Wenn wir dafür jemanden neu einstellen würden, müsste dieser die notwendige Ausbildung – inklusive Feldwebellehrgang – absolvieren. Er würde uns also frühestens in vier Jahren zur Verfügung stehen. Folge: Die Stelle bleibt vakant. Das gilt ebenso für Ärzte – sofern es sich um Stellen für Schiffsärzte handelt oder der Stelleninhaber militärische Fertigkeiten benötigt.
Andere öffentliche Arbeitgeber, wie die Bundespolizei, dürfen dagegen 15 Prozent über dem Stellensoll besetzen. Bei einer Personalstärke der Bundeswehr von 203 000 Dienstposten müssten wir rund 30 000 Stellen zusätzlich im System haben, um soziale Errungenschaften wie die Teilzeitregelung ausgleichen zu können.
Im Sanitätsdienst sieht es zum Beispiel bei den Ärzten so aus: Rein theoretisch werden in diesem Jahr nahezu alle der insgesamt 3 500 Arztstellen besetzt sein. Aufgrund sozial bedingter Abwesenheit und durch Auslandseinsätze stehen der Bundeswehr jedoch rund 600 beziehungsweise weitere 100 Ärzte weniger zur Verfügung. Die fehlen im Tagesdienst, nämlich dort, wo die sanitätsdienstliche Arbeit im Grundbetrieb stattfindet. Hinzu kommen steigende Aus-, Weiterbildungs- und Übungsverpflichtungen, denn Qualitätsstandards führen ebenfalls zu Abwesenheiten.
Draxler: Wie ist die Situation im Marinesanitätsdienst?
Apel: Da sind aktuell 62 von 77 Arztstellen besetzt. Bei den Zahnärzten haben wir für zwei Stellen vier Kollegen und bei den Apothekern ist von fünf Planstellen eine vakant. Die Lücke bei den Portepeeunteroffizieren und Unteroffizieren liegt bei jeweils rund 17 Prozent, während das Fehl bei den Mannschaftsdienstgraden etwa 13 Prozent beträgt. Momentan gibt es genügend Bewerber für den Sanitätsdienst insgesamt – sowohl im Bereich der Pflege als auch bei den Ärzten.
Draxler: Stichwort „Vakanzen“: Ist die sanitätsdienstliche Einsatzfähigkeit für die Flotte gefährdet?
Apel: Im Augenblick noch nicht, aber sie ist extrem schwierig beizubehalten. Die derzeitigen Anforderungen können wir erfüllen, doch der Aufwand ist deutlich angestiegen.
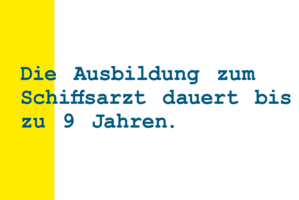
Draxler: Wie erklärt sich das?
Apel: Die Schiffe mit ihren oftmals langen Abwesenheiten von bis zu 220 Tagen im Jahr sind für junge Leute unattraktiv. Wir kompensieren das, steuern um und halten so die Flotte sanitätsdienstlich am Fahren. Ich habe allerdings Sorge, wie man das in Zukunft hinbekommen wird. Im Sanitätsdienst der Marine befinden sich derzeit, vom Schiffsarzt bis zum Gefreiten, 168 Soldaten in der Ausbildung. Und die dauert bis zu neun Jahre. Von den Ärzten abgesehen, bleibt dabei offen, welche Zahl am Ende der Ausbildung zur Verfügung steht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die gesamte Ausbildung – Grundausbildung, Unteroffiziers- und Feldwebellehrgang – innerhalb des Zentralen Sanitätsdienstes nach Heeresstandards erfolgt. Unsere Anwärter erleben die Marine teils erst nach vier oder fünf Jahren – im Alter von schon fast Mitte 20. Und wenn sie dann erfahren, dass sie, wie gesagt, vielleicht über 200 Tage eines Jahres weg von zuhause sind, dann war es das bei manchen.
Draxler: Was unternehmen Sie dagegen?
Apel: Wir versuchen mit Praktika gegenzusteuern, so dass die Anwärter ihr künftiges Arbeitsumfeld früher kennen lernen. Das verschafft beiden Seiten Klarheit. Und es wirkt sich, gerade bei jungen Leuten, positiv auf die Ausbildungsbereitschaft aus, die sich in ihrer Entscheidung für den Marinesanitätsdienst bestätigt sehen. Wer dagegen merkt, dass die Marine nicht seine Welt ist, kann frühzeitig in den Zentralen Sanitätsdienst umsteuern.
Draxler: Wie viele Ärzte sind außerhalb eines approbationsbezogenen (staatliche Zulassung zur Berufsausübung; Anm.) Dienstpostens tätig? Ließe sich da noch eine Reserve heben?
Apel: Da gibt es keine Reserve. Jeder Dienstposten, auf dem ein Sanitätsoffizier tätig ist, hat etwas mit seiner jeweiligen Approbation zu tun. Ob S-1-Offizier, Chef beziehungsweise Kommandeur einer Einheit oder Inspekteur des Sanitätsdienstes – jeder hat neben seiner truppendienstlichen Verantwortung eine Fachaufgabe, die Approbationskenntnisse erfordert. Das reicht von der fachlichen Weiterbildung bis zum Arbeitsrecht.
Draxler: Der Marinesanitätsdienst hat – als erste Teilstreitkrafts-Sanitätsdienst – ein Dezernat „Medizinische Informationstechnologie“ eingerichtet. Sind die zehn Dienstposten ausschließlich mit Informatikern oder Organisationsexperten besetzt?
Apel: Als Verantwortlichen brauche ich da heute einen Arzt. Organisationsexperten haben wir, nur wissen sie nichts von den medizinischen Abläufen und den dafür notwendigen Verfahren. Das könnte sich ändern, wenn wir in Zukunft Medizinassistenten bekommen. Die können nach einer mehrjährigen Berufszeit beurteilen, wo und welche medizinischen Abläufe erforderlich sind. Der aktuelle Dezernatsleiter ist approbiert und hat eine Zusatzausbildung in Medizininformatik. Alle anderen sind Truppenoffiziere und -unteroffiziere. Wir haben auch hier alles unternommen, um nicht unnötig approbierte Kräfte zu binden.
Draxler: Im Bericht des Wehrbeauftragten wird neben der personellen Situation die Materiallage thematisiert respektive kritisiert. Wie sieht es da im Marinesanitätsdienst aus?
Apel: Das muss man differenziert sehen. Bei Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln gibt es keine Probleme, was den täglichen Verbrauch angeht – abgesehen von Lieferengpässen auf dem Weltmarkt. Das kompensieren wir mit Re-Importen, zum Beispiel bei den Impfstoffen. Die sind zu einem großen Teil nicht mehr in Deutschland erhältlich, wir müssen aber insbesondere unsere Auslandskontingente umfassend präventiv impfen.
Engpässe werden darüber hinaus im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Krise auf uns zukommen. Nicht zuletzt betreffen Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und so weiter auch die Marine. Auch hier sind wir von der Entwicklung auf den Märkten abhängig. Hinsichtlich der Risikovorsorge werden wir angesichts dieser Krise unsere Konzepte überdenken müssen. Seit 2012 existieren beispielsweise in den regionalen Sanitätseinrichtungen keine Bettenstationen mehr. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise müssen jetzt Behelfslösungen geschaffen werden.
Draxler: Stichwort Impfstoffimporte: Wie steht es da um die Qualität?
Apel: Wir haben im Sanitätsdienst der Bundeswehr eine eigene Qualitätskontrolle, weil wir keine Abstriche in puncto Sicherheit machen.
Draxler: Was ist mit der Arzneimittelherstellung in den Bundeswehrapotheken?
Apel: Von ehemals vier Herstellungsstraßen arbeitet jetzt nur noch eine, weil der Bundesrechnungshof unsere eigene Herstellung für unwirtschaftlich erklärt hat. Damit ist die Bundeswehr vom handelsüblichen Marktangebot abhängig – ausgenommen bei C-Antidoten (Mittel zur Behandlung von Kampfstoffvergiftungen; Anm.) und Sondermitteln, die es auf dem zivilen Markt nicht gibt. Das bedeutet: Die Bundeswehr wird den Ausfall von Wirkstoffen und Generika aus China oder Indien ebenso spüren wie das zivile Gesundheitswesen.
Draxler: Ist der Anspruch des Sanitätsdienstes, Soldaten medizinisch auf Heimatniveau zu versorgen, im Fall einer NATO-Bündnisverteidigung realistisch?
Apel: Zu Ihrer Frage zwei Anmerkungen: Maxime heißt nicht maximal. Maxime oder besser Richtlinie heißt, wir haben ein bestimmtes Ergebnis anzustreben – das vermitteln wir unseren Soldaten. Zweitens: Es gibt im Fall der Landes- und Bündnisverteidigung eine rechnerische Ausfallquote für einen Großverband im Gefecht, die bei bis zu vier Prozent pro Tag liegt. Das bedeutet, dass ein im Gefecht angeschossener Panzergrenadier nicht unbedingt jene Versorgung erhalten kann, als ob er vor einer Universitätsklinik angeschossen worden wäre – aber das ist unser Ziel.
Wenn es infolge einer Katastrophe zu einem Massenanfall von Verletzten kommt, wird auch in der zivilen medizinischen wie klinischen Versorgung priorisiert (Triage; Anm.). Im zivilen Bereich gelten also ebenfalls planerisch aufgestellte Standards, die lagebedingt angepasst werden müssen. Auf die Marine bezogen, sagen wir unseren Soldaten: Wenn du verletzt wirst, hast du am Ende einer Behandlungsperiode – selbst wenn sie verfahrensbedingt länger als zuhause dauert – die gleiche Lebensqualität, wie wenn du daheim behandelt worden wärest.

Draxler: Nochmals zum Dezernat „Medizinische Informationstechnologie“: Warum wurde es eingerichtet und wie ist der aktuelle Sachstand?
Apel: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens der Bundeswehr wird vom Zentralen Sanitätsdienst vorangetrieben. Sie ist zu 90 Prozent auf die Bedürfnisse von Heer und Luftwaffe zugeschnitten. Unser Problem: Diese landbasierte Digitalisierung lässt sich nicht auf die reale Situation an Bord übertragen. Schon wenn ein Schiff in See dreht, gibt es unter Umständen einen sofortigen Verbindungsausfall, und wir können keine Online-Datenbank nutzen. Was wir brauchen, sind Stand-alone-Lösungen.
Die medizinischen Akten der Bundeswehr basieren, weil datenrechtlich sicherer, auf SAP und Zentraldatenbanken. Wir haben von Bord aus aber keine zuverlässige Verbindung. Wenn der Patient auf See zum Schiffsarzt kommt, lässt sich sein Datensatz im Bundeswehrrechenzentrum nicht sicher aufrufen. Im Fall des Falles bricht auch noch, wie erwähnt, die Verbindung ganz ab. Deswegen müssen wir – in die IT der Flotte eingebunden – unsere eigenen Verfahren entwickeln. Derzeit werden entsprechende Ideen geprüft, sind also noch nicht in der Umsetzung, weil allein die Baumaßnahmen für das benötigte Labor zwei Jahre gedauert haben.
Draxler: Hinkt der Marinesanitätsdienst damit dem Zentralen Sanitätsdienst hinterher?
Apel: Nein, wir sind vom Grundsatz her heute weiter als der Zentrale Sanitätsdienst. Allerdings sind wir auch deutlich kleiner und haben es von daher einfacher.
Draxler: Hätte man die Digitalisierung nicht von der See auf das Land konzipieren können?
Apel: Es war nicht durchzusetzen, die Digitalisierung, von unseren Sonderbedürfnissen ausgehend, hin zum Normalbetrieb zu entwickeln. So hat es Niedersachsen gemacht. Das Land startete seine medizinische Digitalisierung auf den Nordseeinseln. Der Gedanke dahinter leuchtet ein: Was in den abgelegenen Gebieten klappt, funktioniert auf dem Festland garantiert.
Draxler: Warum wird nicht auf See eine Gesundheitsnebenakte geführt, deren Inhalte man später dem Hauptdatensatz auf dem Zentralserver hinzufügt?
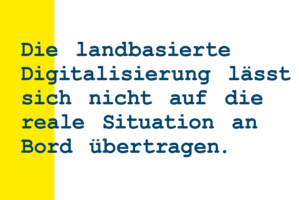
Apel: Das ist leider nicht der Weg, der uns über SAP vorgegeben wird. Danach ist keine Datenhaltung vor Ort vorgesehen, sondern nur eine Datenbearbeitung und -übermittlung an den Zentralserver – wie bei SAP-Logistik und -Personal. Abgesehen davon wäre das ein Bruch in der Konstanz der Dokumentation und in puncto Datensicherheit angreifbar.
Draxler: Worin besteht der Ausweg beziehungsweise Kompromiss?
Apel: Wir kommen derzeit tatsächlich nicht darum herum, an Bord eine Art Akte zu führen, die regelmäßig auf dem Zentralserver repliziert wird, sobald es dem San-Bereich der seegehenden Einheit möglich ist.
Draxler: Was soll mit der Digitalisierung im Sanitätsdienst darüber hinaus erreicht werden?
Apel: Sie zielt auch darauf ab, Verwundete und Kranke für die Rettungskette zu steuern. Unsere Vision ist es, die Vitaldaten des Patienten auf dem Verbandsplatz zu erhalten, bevor er dort eintrifft, beziehungsweise diese Daten vorliegen, selbst wenn der Patient nicht transportiert werden kann, so dass die Kameraden vor Ort beraten werden können. Unsere Medizintechnik bietet diese Möglichkeiten bereits. Was wir auf unseren Schiffen nicht zur Verfügung haben, aber an Bord des Mehrzweckkampfschiffes 180 haben werden, ist ein eigenes Datennetz. Darin können wir diese Daten führen, bearbeiten und weiterleiten.
Draxler: Hat denn bei einer schweren Havarie oder im Gefecht jemand die Zeit, Daten zu dokumentieren oder zu übermitteln?
Apel: Dazu sind wir gezwungen. Mit Meldepapieren ist im Gefecht und in Zeiten, in denen viele Menschen kaum noch schreiben und nur noch tippen können, schwer zu arbeiten. Da geht schnell etwas unter, und dann entstehen große Probleme, da wichtige Daten wie die Herzfrequenz erste Hinweise über den Zustand eines Patienten geben.
Draxler: Herr Admiralarzt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Fregattenkapitän d.R. Mag. Jürgen R. Draxler ist Militärjournalist und Publizist.