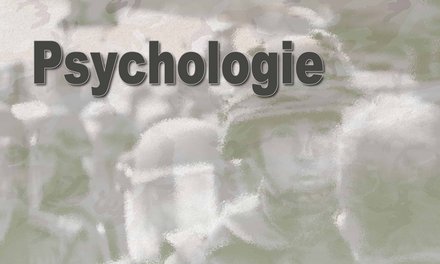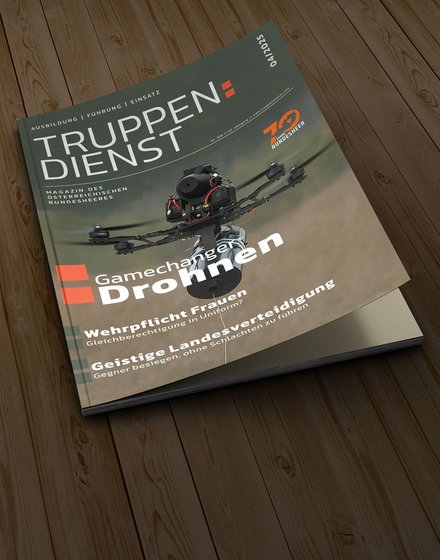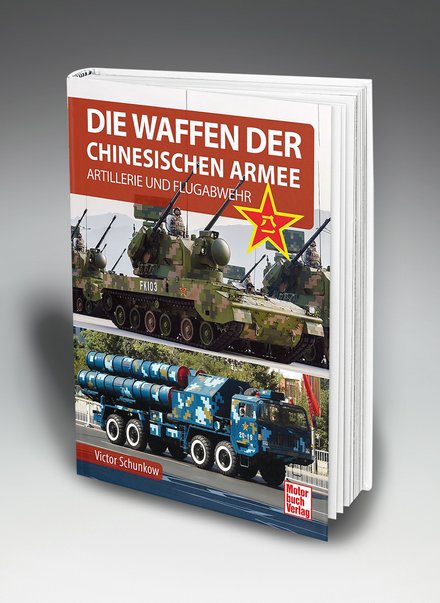Stabil im Einsatz

Heulende Sirenen, Lärm von Artillerie und Maschinengewehren, Querschläger und herabfallende Teile von Raketen oder Flugabwehrmunition sowie viele Stunden und Tage im Bunker ohne Verbindung in die Heimat. Der UNIFIL-Einsatz ist für die Soldaten des Österreichischen Bundesheeres eine außerordentliche Herausforderung. Heerespsychologen erzählen von psychologischen Belastungen im Einsatzraum und der Vor- und Nachbetreuung der Soldaten zu Hause.
Mit welchen psychologischen Belastungen sind österreichische Soldaten beim UNIFIL-Einsatz im Libanon konfrontiert? Wie sieht ihre Vorbereitung aus? Wie werden sie im Einsatz betreut? Was müssen sie nach ihrer Rückkehr beachten? TRUPPENDIENST-Redakteur Gerold Keusch sprach mit Georg Ebner und Helmut Slop von der Auslandseinsatzbasis in Götzendorf. Die beiden erfahrenen Heerespsychologen sind für die psychologische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Soldaten bei Auslandseinsätzen verantwortlich.
Keusch (K): Warum ist das Thema Psychologie im Österreichischen Bundesheer wichtig?
Ebner (E): Psychologie begleitet den gesamten militärischen Alltag. Egal ob im Inland oder im Auslandseinsatz – ohne psychische Stabilität kann kein Soldat seine Aufgaben erfüllen. Themen wie Familienprobleme, traumatische Erlebnisse oder Stress im Einsatz können nicht einfach abgeschaltet oder ausgeblendet werden, wenn diese vorhanden sind. In Auslandseinsätzen wie im Libanon, wo die Bedrohungslage hoch ist und die Kommunikation nach Hause oft tagelang ausfällt, ist die psychologische Betreuung besonders wichtig. Denn wenn es zu Hause Probleme gibt und die Akzeptanz für den Einsatz nicht oder nicht mehr gegeben ist, dann ist dieser für den Betroffenen gefährdet.
K: Welche speziellen psychischen Herausforderungen gibt es aktuell im Libanon-Einsatz?
E: Der aktuelle UNIFIL-Einsatz ist durch ständige Bedrohungen wie Beschuss, Raketenangriffe oder Drohneneinsätze gekennzeichnet. Diese Gefahren erzeugen eine enorme psychische Belastung. Hinzu kommt die Trennung von der Familie, die oft wochen- oder monatelang dauert. Viele Soldaten fühlen sich hilflos, wenn zu Hause etwas passiert und sie nicht eingreifen können. Die fehlende Routine im Umgang mit solchen Ereignissen und die ständige Unsicherheit verschärfen die Situation.
Slop (S): Die psychische Belastung durch die Hilflosigkeit ist nicht zu unterschätzen. Wenn ein Soldat weiß, dass es zu Hause Probleme gibt und er nichts tun kann, erzeugt das einen enormen Stress. Das kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung im Einsatzraum führen. Beispielsweise kann ein Kommandant, der gedanklich ständig bei seiner Familie ist, seine Verantwortung vor Ort nicht voll wahrnehmen.
K: Wie bereiten Sie die Soldaten auf solche Herausforderungen vor?
S: Wir bereiten die Soldaten umfassend vor, indem wir auf möglichst alle potenziellen Stressfaktoren hinweisen und konkrete Strategien zur Bewältigung vermitteln. Ein wichtiger Bestandteil ist es, realistische Erwartungen zu schaffen. Die Kommunikation mit der Familie wird nicht immer möglich sein, und es können unvorhergesehene Ereignisse auftreten. Die Soldaten lernen, wie sie mit diesen Situationen umgehen und wie sie sich selbst stabilisieren können.
K: Wie sieht die psychologische Einsatzvorbereitung konkret aus?
E: Die psychologische Einsatzvorbereitung ist ein mehrstufiger Prozess, der mehrere Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen kann. Zu Beginn gibt es Schulungen zu allgemeinen Themen wie Stressbewältigung, Kommunikation und Selbstfürsorge. Diese Schulungen werden sowohl theoretisch als auch praktisch durchgeführt.
S: Ein wichtiger Punkt ist die Aufklärung über psychische Belastungen, die im Einsatz auftreten können. Dazu gehören insbesondere das Gefühl der Isolation und die Tatsache, lange von der Familie, die Tausende Kilometer entfernt ist, getrennt zu sein. Wir sensibilisieren die Soldaten, frühzeitig Anzeichen solcher Belastungen zu erkennen und aktiv Hilfe zu suchen, bevor Probleme eskalieren. Bei der Einsatzvorbereitung werden Stresssituationen, die im Einsatz auftreten können, simuliert, und anschließend besprochen, wie man am besten mit diesen umgehen kann.
Hofrat Oberst dhmfD Mag. Dr. Georg Ebner
- Militärpsychologe der Auslandseinsatzbasis
- Diplomstudium Psychologie in Graz
- Doktoratsstudium in Klagenfurt von 2010 bis 2017 im Fach Interventionsforschung
- Klinischer, Gesundheits-, Arbeits-, Wirtschafts-, Organisations-, Notfall- und Militärpsychologe
- mehrere Auslandseinsätze bei KFOR, AFDRU, UNIFIL und EUFOR
K: Welche Rolle spielen die Familien bei der Vorbereitung auf einen Einsatz?
E: Das Einbeziehen der Familie ist ein zentraler Bestandteil bei der Einsatzvorbereitung. Die Angehörigen der Soldaten erhalten spezielles Informationsmaterial, können sich auch persönlich bei uns melden und sich sogar mit uns treffen. Bei diesen Treffen erklären wir ihnen, was ihre Partner, Söhne oder Töchter im Einsatz erwartet. Dabei geht es um praktische Fragen wie Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch um emotionale Herausforderungen. Wir raten den Soldaten, gemeinsam mit ihren Familien klare Regeln zu vereinbaren, wie und wann sie Kontakt halten wollen. Das schafft Sicherheit auf beiden Seiten.
S: Es ist wichtig, den Familien Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie mit der Abwesenheit ihres Angehörigen umgehen können. Neben den Broschüren mit Tipps gibt es Anlaufstellen, an die sich Angehörige bei Problemen wenden können. Ein stabiles familiäres Umfeld ist entscheidend für die psychische Gesundheit der Soldaten – nicht nur im Allgemeinen, sondern vor allem im Einsatz. Wenn die Familie weiß, was auf sie zukommt, reduziert das die Belastung für alle Beteiligten wesentlich.
K: Wie werden individuelle Sorgen und Ängste der Soldaten behandelt?
E: Jeder Soldat hat die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit einem Psychologen. In diesen Gesprächen gehen wir auf individuelle Sorgen und Ängste ein. Manche Soldaten haben bereits vor dem Einsatz familiäre Probleme oder traumatische Situationen erlebt, die sie belasten. In solchen Fällen entwickeln wir gemeinsam einen Plan, wie sie mit diesen Belastungen umgehen können. Falls notwendig, ziehen wir weitere Spezialisten hinzu, um gezielt Hilfe zu leisten.
S: Wir betonen immer wieder, dass es keine Schande ist, Schwächen oder Sorgen zuzugeben. Im Gegenteil: Wer sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist und frühzeitig Hilfe sucht, handelt verantwortungsvoll. Dieses Bewusstsein hilft nicht nur den Soldaten selbst, sondern auch den Kameraden und der gesamten Einheit.
K: Wie sieht die Schulung der Kommandanten auf psychologischer Ebene aus?
S: Kommandanten haben eine besondere Verantwortung für ihre Soldaten. Deshalb bieten wir ihnen gezielte Schulungen an, um sie auf ihre Führungsrolle im Einsatz vorzubereiten. Sie lernen, wie sie Anzeichen von psychischen Belastungen bei ihren Soldaten frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren können. Dabei geht es auch um die eigene Belastbarkeit. Ein Kommandant, der gut für sich selbst sorgt, kann seine Soldaten besser unterstützen.
K: Welche Aufgabe erfüllt die Heerespsychologie während eines Auslandseinsatzes?
E: Im Einsatz ist der Psychologe Ansprechperson für alle psychischen Belange der Soldaten des Kontingentes. Er berät aber nicht nur, sondern nimmt auch aktiv am Leben der Truppe teil. Beispielsweise begleitet er Patrouillen, redet beim Kaffee mit den Soldaten, nimmt an Besprechungen teil oder ist bei Freizeitaktivitäten vor Ort. Durch diese präsente Unterstützung entsteht Vertrauen und die Hemmschwelle sinkt, um Hilfe in Anspruch zu nehmen.
S: Ein Psychologe muss proaktiv sein. Er wartet nicht im Büro, sondern sucht den Kontakt zu den Soldaten. Das kann durch einen kurzen Small Talk beim Mittagessen oder beim gemeinsamen Training geschehen. Durch diese alltäglichen Interaktionen wird die psychologische Betreuung zu einem normalen Bestandteil des Einsatzes. In diesem Zusammenhang möchte ich die strikte Trennung zwischen der Betreuung von Soldaten im Auslandseinsatz und der Personalauswahl für einen Auslandseinsatz betonen. Hier gibt es noch immer Missverständnisse. Unsere Aufgabe ist die Unterstützung von Soldaten im Einsatz. Das Feststellen der psychologischen Tauglichkeit, die Bewertung, erfolgt im Zuge der Eignungsfeststellung für den Auslandseinsatz. Das sind zwei völlig unterschiedliche Felder, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
E: Neben den Heerespsychologen gibt es auch noch die Peers. Das sind jene Kameraden, die als psychologische Ersthelfer ausgebildet sind und im Einsatz eine wichtige Stütze sein können. Oftmals fällt es den Soldaten leichter, mit einem Kameraden über traumatische Erlebnisse zu reden als mit einem Psychologen. Die Etablierung des Buddy-Systems ist für das seelische Wohlbefinden ebenfalls enorm wichtig. Aufeinander aufpassen, aufeinander achten, helfen, wenn sich jemand verändert, aber auch selber Hilfe einfordern, ist bedeutend. Die Relevanz des Zusammenhaltes und der gegenseitigen Unterstützung wird den Soldaten von psychologischer Seite mit Nachdruck vermittelt.
S: Der Psychologe beobachtet zudem die Stimmung in der Truppe und achtet auf Anzeichen von Erschöpfung, Angst oder Konflikten. Wenn er bemerkt, dass jemand unter Druck steht oder sich zurückzieht, spricht er die Person gezielt an. Oft hilft ein kurzes Gespräch, um Belastungen zu lindern und die Situation zu entspannen.
Hofrat Oberst dhmfD Mag. Helmut Slop, MA
- Leiter Referat Psychologie der Auslandseinsatzbasis und Militärpsychologe
- Psychologiestudium an der Universität in Innsbruck mit Schwerpunkt Angewandte Psychologie in der Personalauswahl
- Klinischer und Gesundheitspsychologe; Notfallpsychologe; zertifizierter Konflikt- und Mobbingberater; Betreuungspsychologe für den Sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im Militärkommando Burgenland
- zahlreiche Auslandseinsätze als Betreuungspsychologe bei UNDOF, UNFICYP, EUFOR und UNIFIL
K: Was passiert, wenn ein Soldat im Einsatz psychische Probleme bekommt?
S: Wenn wir rechtzeitig intervenieren können, ist vieles lösbar. Manchmal hilft eine kurze Heimkehr, um eine Krise zu bewältigen, dann muss nur der Urlaub verschoben werden. Der Psychologe vor Ort entscheidet gemeinsam mit dem Kommandanten, ob das nötig ist. Bei schwereren Problemen kann auch eine Rückführung angeordnet werden, das ist aber die absolute Ausnahme.
E: Wichtig ist, dass die Soldaten wissen: Psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Wer Hilfe annimmt, handelt verantwortungsvoll – für sich und seine Kameraden.
K: Haben Sie das Gefühl, dass Soldaten heutzutage einen anderen Zugang zu ihren Gefühlen haben? Sind in diesem Bereich Tabus gefallen?
S: Ja, ich denke schon. Das hängt auch damit zusammen, dass Frauen heute eine Selbstverständlichkeit im Bundesheer sind, wodurch sich diese Enttabuisierung sicherlich beschleunigt hat. Frauen gehen meist natürlicher mit Gefühlen um. Sie reden eher über Erschütterung, Verzweiflung und traumatische Ereignisse als Männer. Das hilft wiederum den männlichen Kameraden, sich zu öffnen und so emotionalen Druck abzubauen. Die Teilnahme von Frauen an Auslandseinsätzen wirkt sich jedenfalls positiv auf das Gesamtklima eines Kontingentes aus.
K: Gibt es Unterschiede in der psychologischen Betreuung von Frauen und Männern?
E: In der Betreuung nicht. Frauen und Männer machen denselben Job und haben dieselben Belastungen.
S: Frauen im Auslandseinsatz sind mittlerweile selbstverständlich. Die Herausforderungen sind die gleichen. Es geht darum, gemeinsam als Team zu funktionieren und sich zu unterstützen.
K: Wie unterstützen Sie die Soldaten nach der Rückkehr?
E: Nach den Einsätzen führen wir intensive Gespräche mit den Soldaten. Beim UNIFIL-Einsatz nehmen wir uns pro Person bis zu 40 Minuten Zeit. Das ist länger als bei anderen Missionen, bei denen die psychische Belastung jedoch geringer ist. Die Soldaten erhalten Tipps, wie sie sich wieder in das Familienleben integrieren können. Geduld ist entscheidend – sowohl vonseiten der Soldaten als auch von den Familien. Die Erlebnisse eines Einsatzes lassen sich nicht einfach abschütteln. Der Soldat, der im Auslandseinsatz war, hat Dinge gesehen und erlebt, die die Zurückgebliebenen niemals verstehen werden.
S: Man darf nicht vergessen, dass sich auch die Familie während des Einsatzes verändert und weiterentwickelt hat. Die heimgekehrten Soldaten müssen sich wieder eingewöhnen. Das Buddy System hilft hier ebenso, und es ist wichtig, dass sich Kameraden auch nach der Rückkehr gegenseitig unterstützen.
K: Gibt es besondere Herausforderungen nach einem UNIFIL-Einsatz?
E: Ja, weil die hohe Bedrohungslage Spuren hinterlässt. Manche Soldaten sind schreckhafter oder reagieren empfindlich auf laute Geräusche. Das ist normal und nimmt mit der Zeit ab. Bei anhaltenden Problemen ist es wichtig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu diesem Zweck gibt es im Bundesheer viele Anlaufstellen – vom Peer über den Heerespsychologen bis zum Traumazentrum.
K: Was ist die wichtigste Botschaft für einen Soldaten im Auslandseinsatz aus der Sicht der Psychologie?
S: Psychologische Betreuung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Wer Hilfe annimmt, sorgt dafür, dass der Einsatz erfolgreich ist.
E: Nur psychisch stabile Soldaten können den mannigfaltigen Anforderungen gerecht werden. Die Psychologie hilft, diese Stabilität zu sichern – vor, während und nach dem Einsatz.
UNIFIL-Einsatz des Bundesheeres
Die United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) wurde im März 1978 durch die Resolutionen 425 und 426 des UN-Sicherheitsrates ins Leben gerufen. Der Einsatz entstand infolge der damaligen israelischen Invasion im Südlibanon. Ziel war es, den Rückzug der israelischen Streitkräfte zu überwachen und die libanesische Regierung bei der Wiederherstellung ihrer Kontrolle über das betroffene Gebiet zu unterstützen. Seitdem wurde das Mandat der Mission mehrfach angepasst, zuletzt 2006 nach dem Libanon-Krieg durch die Resolution 1701. Diese ermöglichte eine Verstärkung der UNIFIL-Truppe auf bis zu 15 000 Soldaten inklusive Marine-Einheiten.
Das UNIFIL-Mandat umfasst drei wesentliche Aufgaben:
- Überwachung des Waffenstillstandes zwischen Israel und dem Libanon;
- Begleitung der libanesischen Streitkräfte beim Einsatz im Südlibanon;
- Sicherstellung, dass der Südlibanon nicht für feindliche Aktivitäten gegen Israel genutzt wird.
Das primäre Ziel von UNIFIL ist die Wahrung des Friedens und der Sicherheit entlang der Blauen Linie, der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon. UNIFIL arbeitet daran, Eskalationen zu verhindern und das Vertrauen zwischen den Konfliktparteien zu stärken. Zudem soll die Mission den Frieden in der Region stabilisieren und einen sicheren Raum für humanitäre Hilfe schaffen.
Seit November 2011 beteiligt sich Österreich mit einem Logistikkontingent an der UNIFIL. Derzeit sind etwa 180 österreichische Soldaten im Camp Naqoura stationiert, das sich etwa 110 Kilometer südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut befindet. Insgesamt sind knapp 12 000 Soldaten sowie 1 000 UN-Zivilangestellte aus mehr als 40 Staaten Teil der Mission. Die österreichische Teilnahme an der UNIFIL-Mission ist ein klares Bekenntnis zur internationalen Friedenssicherung und regionalen Stabilität. Die Hauptaufgaben des Kontingentes des Bundesheeres innerhalb der Transporteinheit „Multi Role Logistic Unit“ sind:
- Transport von Personal und Ausrüstung;
- Bergen und Instandsetzen von UNIFIL-Fahrzeugen;
- Versorgung der UN-Truppe mit Treibstoff;
- Betreiben der Camp-Feuerwehr;
- Unterstützung bei der Lagerhaltung;
- Transport von Cargo-Gütern.
Mit mehr als 100 Fahrzeugen, darunter Geländewagen, Sattelschlepper, Busse, Berge-, Lösch- und Tankfahrzeuge, tragen die österreichischen Soldaten zur Stabilisierung der Region bei und helfen, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Lage im Nahen Osten ist derzeit besonders angespannt. Das beeinflusst auch den UNIFIL-Einsatz. Besonders die Eskalationen entlang der Blauen Linie erfordern ständige Wachsamkeit. Österreich ist in enger Abstimmung mit internationalen Partnern, bleibt aber trotz der angespannten Sicherheitslage vor Ort und führt seine Aufgaben im Rahmen dieser Mission fort. Die Sicherheit der Soldaten des österreichischen UNIFIL-Kontingentes hat jedoch oberste Priorität.
Hofrat Gerold Keusch, BA MA; Leiter Online-Medien in der Redaktion TRUPPENDIENST

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 1/2025 (402).