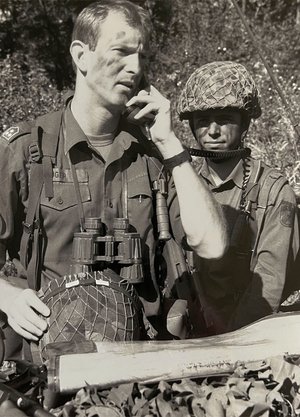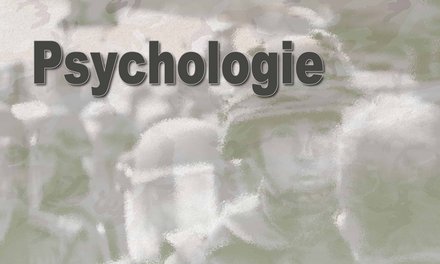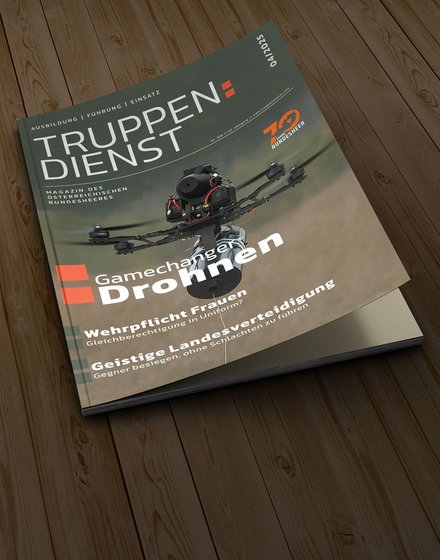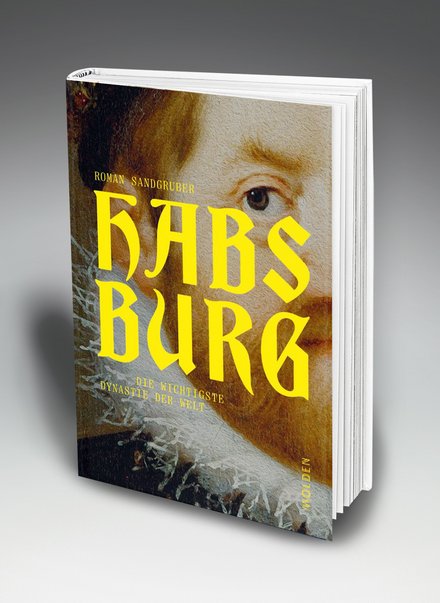Entschlossenheit trifft auf Empathie

Eine völkerrechtswidrige Invasion im Osten Europas, die bereits seit über drei Jahren die internationale Weltordnung erschüttert, sowie zahlreiche weitere Eskalationen zeigen: Der Krieg als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, wie es der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz ausdrückte, ist wieder zurück.
Gemäß Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta dürfte kein Staat gegen einen anderen Staat militärische Gewalt anwenden oder diese androhen. Bis heute stellt dies einen Eckpfeiler der Staatenordnung dar, der auf den Erfahrungen der beiden Weltkriege beruht, wie in der Präambel der UN-Charta hervorgehoben wird. Nicht erst seit dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien oder der widerrechtlichen Krim-Annexion beobachten Experten eine zunehmende Erosion des völkerrechtlichen Gewaltverbotes.
Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob sich das Bundesheer in seiner Führungsphilosophie neu ausrichten muss. Jahrzehntelang standen Stabilisierungs- sowie Assistenzeinsätze im Vordergrund, die Generationen von Soldaten geprägt haben. Ist das Bundesheer aber auch auf einen „großen Schießkrieg“ – wie die Abwehroperation oft vereinfacht übersetzt wird – ausgerichtet? Franz Stefan Gady schreibt in seinem Buch „Die Rückkehr des Krieges“: „Wir müssen uns dem Phänomen Krieg wieder stellen und wissen, wie wir ihn im Ernstfall so führen können, dass wir eine Chance haben, ihn zu gewinnen.“
Müssen wir die militärische Führung und das Anforderungsprofil an unsere Kommandanten angesichts all dieser sicherheitspolitischen Umwälzungen neu denken? Der folgende Beitrag ist als Denkanstoß in diese Richtung gedacht.
Führung auf dem Gefechtsfeld
In Anbetracht der allgegenwärtigen Bedrohungen auf dem gläsernen Gefechtsfeld für Führungseinrichtungen sowie der enormen Informationsmenge, denen Kommandanten gegenüberstehen, müssen so manche Doktrinen überdacht und neu beurteilt werden. Aktuell haben überdimensionierte und ungeschützte Gefechtsstände keine Überlebenschance: In Sekundenschnelle werden durch Drohnen, Satelliten oder die Elektronische Kampfführung Führungseinrichtungen erkannt und innerhalb kürzester Zeit angegriffen.
Kommandanten und ihre Stäbe sind als „High-Value-Targets“ begehrte Ziele für gegnerisches Feuer. Dementsprechend hoch ist die Priorität im Targeting-Prozess, die ihnen zugesprochen wird. Das Novum in den neuesten Entwicklungen ist das Fehlen eines sicheren Rückzugsortes für Gefechtsstände, der in der Vergangenheit noch durch die Beurteilung der Reichweiten der Artillerie in gewissem Ausmaß gegeben war.
Drohnenaufklärung und -angriffe verdeutlichen eindringlich, dass dies in der heutigen Zeit nicht mehr ausreicht. Führungseinrichtungen bleiben nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Risikominimierung: entweder durch Mobilität oder durch umfassenden Schutz. Letzterer lässt sich nur durch eine solide Infrastruktur möglichst tief unter der Erde sicherstellen. Die Mobilität bedingt wiederum eine drastische Verkleinerung des Stabes, um zeitnah lebensrettende Stellungswechsel zu ermöglichen. Die Brigadestäbe, die auf mehrere Hundert Soldaten angewachsen sind und westliche Armeen in Stabilisierungseinsätzen einsetzen, gehören somit der Vergangenheit an.
Ein weiterer Lösungsansatz wäre die räumliche Dislozierung von Gefechtsständen ab einer gewissen Ebene weit weg von der Front. Moderne Führungsunterstützungs- und Führungsinformationssysteme würden diese Entkoppelung des Kommandanten und seines Stabes vom Gefechtsfeld grundsätzlich zulassen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit sich die Präsenz des militärischen Führers auf dem Gefechtsfeld, beziehungsweise seine Abwesenheit, auf die Moral der kämpfenden Truppe auswirkt. Der seiner Armee voranreitende Feldherr, der seine Soldaten durch seinen gezückten Säbel und seine Ansprachen inspiriert, mag zwar schon länger ein veraltetes Klischee sein, die unmittelbare Auswirkung der Anwesenheit eines Kommandanten darf aber trotzdem nicht unterschätzt werden.
Einem militärischen Führer, der die Gefahr mit seinen Untergebenen teilt, folgt man eher, als jemandem, der kilometerweit in der Ferne im sicheren Bunker sitzt. Andererseits hat die in einer geschützten Anlage sitzende Führung vielleicht einen ruhigeren Kopf, um das Gefecht zu führen, als ein Kommandant, der sich neben der Führung seiner Verbände auch noch um sein eigenes Überleben sorgen muss. Diese schwierige Abwägung zwischen eigener Sicherheit, Führungsleistung und Auswirkungen auf die Moral sowie den Einsatzwillen der Truppe wird eine zentrale Frage für militärische Führungsdoktrinen der Zukunft sein.
Informationsflut
Noch nie in der Geschichte standen den Kommandanten so viele und so rasch verfügbare Informationen für ihre Entscheidungen zur Verfügung wie heute. Eine Herausforderung ist die Verarbeitung dieser Datenmengen, wobei die Künstliche Intelligenz enormes Potenzial hat, dem militärischen Führer unter die Arme zu greifen. Betrachtet man die Tendenz zur Verkleinerung der Stäbe, so wird an einer Implementierung dieser neuen Technologien für Führungseinrichtungen kein Weg vorbeiführen, da andernfalls eine Verarbeitung der Daten nicht zeitgerecht erfolgen kann.
Dieser Kampf um die Informationsüberlegenheit wird das Gefechtsfeld der Zukunft maßgeblich bestimmen: Wem es gelingt, Daten wie Fakten schneller auszuwerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, der wird als Sieger aus dem Gefecht hervorgehen. Gemeinsam mit dieser Informationsflut geht eine – vor allem im Osten Europas – zu beobachtende Führung von überdehnten Verantwortungsbereichen einher. Obwohl Kommandanten aufgrund der erheblichen Distanzen keinen direkten Einblick ins Gelände nehmen können, weil die Ausdehnung der Räume dies nicht mehr zulässt, ermöglichen Drohnen Live-Bilder zu sämtlichen Einzelheiten des Gefechtsfeldes.
Diese neue Unmittelbarkeit wirft die Frage auf, ob Kommandanten höherer Ebenen dadurch zum Mikromanagement in die untersten Führungsebenen hinein verleitet werden – was der westlichen Idee der Auftragstaktik widersprechen würde. In einer radikalen Betrachtungsweise könnten diese modernen technologischen Möglichkeiten dazu führen, gewisse Führungsebenen einzusparen, da diese aufgrund der Kapazitäten zur Informationsauswertung und Entscheidungsaufbereitung auf höheren Ebenen nicht mehr erforderlich sind.
Abschließende Aussagen über Führungsdoktrinen lassen sich aufgrund dieser ersten Erkenntnisse noch nicht treffen. Es kristallisiert sich heraus, dass der Kommandant von morgen kognitiv stärker gefordert sein wird. Insbesondere das dynamische Umfeld verlangt eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Denken und Handeln. Die Gefahren erfordern eine hohe Belastbarkeit, sowohl psychischer als auch physischer Natur. Nur wer körperlich fit ist, hat im Krisenfall noch die geistigen Kapazitäten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotz aller technologischen Fortschritte werden auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft immer noch Menschen geführt. Daher sind die soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit empathisch zu führen von großer Bedeutung.
Führung im Bundesheer
Als Folge des Krieges auf europäischem Boden wird das Bundesheer gegenwärtig einem Aufbauprogramm zur Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit unterzogen. Der Aufbauplan ÖBH 2032+ soll das Bundesheer zur militärischen Landesverteidigung befähigen. Die Ausrichtung der Streitkräfte auf die militärische Landesverteidigung lässt das oberste Ziel der militärischen Führung – die Erringung des Erfolges im Kampf – aktueller denn je erscheinen.
Der überwiegend stabilisierende Charakter der Einsätze des Bundesheeres der vergangenen 25 Jahre im internationalen Krisenmanagement mit der Ausrichtung, Krisen an ihrem Entstehungsort zu begegnen, das europäische Umfeld zu stabilisieren und Österreich als verlässlichen Partner zu verankern, hat das militärische Führungsverständnis mehrerer Generationen österreichischer Offiziere und Unteroffiziere maßgeblich geprägt.
Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert Russland die europäische Friedensordnung: Nach 75 Jahren ist der Krieg wieder auf das europäische Territorium zurückgekehrt. Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, die Besonderheiten der militärischen Führung im Ernstfall, insbesondere im Verteidigungsfall der Republik Österreich, zu schärfen.
Militärische Führung
Militärische Führung ist laut österreichischem Militärlexikon „ein richtungweisendes, steuerndes und motivierendes Einwirken auf Kommanden, Truppen, Dienststellen und einzelne Personen, um eine Zielvorstellung zu verwirklichen und die Organisation zu optimieren“.
In Anbetracht dessen besteht die Besonderheit militärischer Führung im Krieg darin, dass diese auch unter außergewöhnlichen Belastungen – insbesondere im Kampfeinsatz – wirksam werden muss. Militärische Führer müssen bei Ausfällen von Personal und Material unter Zeitdruck und in ungeklärter Lage handeln. Die Forderung an den Soldaten, sein Leben einzusetzen sowie die Pflicht des militärischen Führers, dies von sich selbst und anderen zu fordern, verleihen der Führung von Menschen ein außerordentliches Gewicht.
Führungssystem
Das Führungssystem des Bundesheers ist der geordnete Zusammenhang von Führungsgrundsätzen, Führungsorganisation, Führungsverfahren sowie Führungsinstrumenten und ermöglicht die militärische Führung von Soldaten, Truppen und Dienststellen unter Friedens- und Einsatzbedingungen. Auf internationaler Ebene werden die Merkmale des Führungssystems des Bundesheeres unter dem Begriff „Command“ zusammengefasst.
Es gibt noch eine weitere Dimension, die entscheidend ist, um im Gefecht erfolgreich zu führen: das spezifische Führungsverhalten des Kommandanten, der sowohl soldatische Tugenden als auch Führungspersönlichkeit zu vereinen hat – international als Leadership bekannt. Der Chef des österreichisch-ungarischen Generalstabes, Feldmarschall Franz Conrad von Hötzendorf, stellte dazu fest: „Der Krieg wird von Menschen geführt. Wer den Krieg verstehen will, muss daher vor allem den Menschen in seinen Reaktionen gegenüber physischen und seelischen Einflüssen kennenlernen.“
Gerade dieser menschliche Aspekt der militärischen Führung stellt außerordentlich hohe Anforderungen an die seelischen, geistigen, moralischen und körperlichen Kräfte von Kommandanten. In Zeiten einer informatisierten, entgrenzten und beschleunigten Kriegsführung hat sich vor allem der militärische Kommandant zu bewähren, der Menschen unter Todesbedrohung führt. Anhand der folgenden drei Elemente lässt sich das Führungsverhalten in einem verteidigungsfähigen Bundesheer charakterisieren:
- Der Kommandant ist integraler Bestandteil seiner unterstellten Truppe. Je höher die Führungsebene, desto weniger kann der Kommandant Teil des von ihm geführten Elementes sein. Umso mehr kommt es darauf an, Vertrauen durch seine Führungsmaßnahmen zu bilden und zu erhalten.
- Vertrauen erwirbt, wer durch Wissen, Können und Leistung überzeugt, beherrscht und maßvoll ist, Gerechtigkeit und Geduld übt, Verständnis für den anderen hat, dessen Würde und Rechte achtet und der unermüdlich für seine Untergebenen sorgt. Je härter die Anforderungen und je größer die Entbehrungen, desto stärker muss der Soldat die Fürsorge seiner Vorgesetzten spüren, die dieselben Entbehrungen auf sich nehmen wie er.
- Die Truppe besitzt einen hohen Ausbildungsstand, der sich an den Erfordernissen des Einsatzes misst.
Führung von Menschen
Führung im militärischen Kontext ist eine vielschichtige Aufgabe, die weit über das Erteilen von Befehlen hinausgeht. Sie erfordert ein tiefes Verständnis für Menschen, eine klare Vision und die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen zu agieren. Ein erfolgreicher militärischer Führer ist eine Person, die sowohl die Kunst der Führung beherrscht und ein tiefes Verständnis für die Menschen hat, um sie zu inspirieren – also Menschenführung im wahrsten Sinne des Wortes.
Die ehemalige Dienstvorschrift des Bundesheeres „Truppenführung“ stellte fest: „Kampfwille und Kampfmoral der Truppe hängen weitgehend von der Haltung aller Führer ab und stehen in Wechselbeziehung zum Verteidigungswillen von Staat und Volk.“ Genau diese Haltung ist es, die den entscheidenden Unterschied ausmacht, wann immer es sich um Menschenführung in Zeiten des Friedens, einer Krise oder des Krieges handelt. Das Militär im Allgemeinen und das Gefecht im Besonderen beruhen auf sorgfältiger Planung.
Obwohl der Grundsatz „Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt“ weit verbreitet ist, halten Streitkräfte oftmals an formalisierten Prozessen und starren Strukturen fest, selbst wenn die Situation andere Verhaltensmuster erfordert. Generell versteht sich das Militär seit jeher als Organisation, die mit Unsicherheit umzugehen weiß. Drill, Ausbildung, Übungen, Planspiele und Einsatzvorbereitung sollen genau das leisten: Ordnung schaffen, wo Chaos herrscht.
Kein System mehr
Doch was passiert, wenn das Unerwartete nicht nur eine militärische Lageänderung darstellt, sondern einen strukturellen Bruch mit allem Vertrauten? Inwieweit sind militärische Kommandanten auf Situationen vorbereitet, in denen keine Systeme mehr wirksam und nur noch die Persönlichkeit, der Charakter und die Improvisation von Bedeutung sind? Die einschlägigen Führungserfahrungen des Polarforschers Sir Ernest Shackleton zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Antarktis können dabei behilflich sein, sich diesem Thema zu nähern.
Im Jahr 1914 brach Shackleton mit einer Mannschaft von 27 sorgfältig ausgewählten Männern auf einem eisgängigen Schiff von England auf, um die vollständige Durchquerung der Antarktis in Angriff zu nehmen. Nachdem das Schiff, die Endurance, vom Eis zerdrückt wurde, musste er seinen ursprünglichen Plan ohne Karte, ohne Kommunikationsmittel und ohne Nachschub völlig neu denken. Dabei wandte er folgendes Prinzip an: Orientierung an der Realität, nicht am Ideal.
Seine Entscheidungen traf er situationsabhängig, immer mit einem Auge auf die psychische und physische Verfassung seiner Mannschaft. Statt einen starren Kurs zu verfolgen, wechselte er die Route, manchmal sogar das Konzept von Führung, aber nie die Verantwortung. Der Polarforscher führte seine Mannschaft durch eine Krisensituation, für die es keinen Plan, keine Vorbereitung und keine Vorschrift gab. Was ihn leitete, war keine Checkliste, sondern Haltung, Anpassungsfähigkeit und der unbedingte Wille zur Verantwortung. Die Prinzipien von Shackleton in dieser schier aussichtslosen Krisensituation seiner Antarktis-Expedition können anhand von vier Teilbereichen dargestellt werden: Optimismus, Flexibilität, Empathie und Entscheidungsfreude.
Optimismus
Als die Endurance in der Weddell-See eingeschlossen und vom Eis zerstört wurde, zeigte Shackletons Reaktion auf diese Katastrophe seine außergewöhnliche Fähigkeit, Hoffnung in scheinbar ausweglosen Situationen zu bewahren. Statt in Resignation zu verfallen, entschied er sich für den Optimismus
als Mittel gegen die Verzweiflung. Shackletons Optimismus war jedoch kein blindes Wunschdenken, sondern gründete auf einer tiefen Vertrautheit mit den Herausforderungen, die die Antarktis stellte.
Er wusste, dass die moralische Stärke seiner Mannschaft ebenso wichtig war wie ihre physische Überlebensfähigkeit. Durch tägliche Routinen, die Förderung von Gruppenaktivitäten und das persönliche Engagement für das Wohl jedes Einzelnen stärkte Shackleton den Zusammenhalt und die Entschlossenheit seiner Mannschaft selbst unter extremsten Bedingungen. Die Kraft des Optimismus, die Shackleton demonstrierte, war weit mehr als bloße positive Stimmung. Durch sein Vorbild lehrte Shackleton seine Männer, dass mentale Einstellung und psychische Widerstandsfähigkeit entscheidende Faktoren im Überlebenskampf sein können.
Flexibilität
Shackleton musste sein ursprüngliches Ziel, den antarktischen Kontinent zu durchqueren, aufgeben. Stattdessen konzentrierte er sich voll und ganz auf das Überleben und die Rettung seiner Mannschaft. Die Bereitschaft, Ziele zu überdenken und neue Wege zu entwickeln, ohne dabei die Überzeugung und das Vertrauen der Mannschaft zu verlieren, ist entscheidend. Diese Fähigkeit, sich an dramatisch veränderte Umstände anzupassen, wurde besonders deutlich, als Shackleton und seine Mannschaft gezwungen waren, einige Monate auf einer Eisscholle zu überleben.
Shackletons Entscheidungen, beginnend von der Auswahl des Lagerplatzes bis hin zur Aufteilung der wenigen verfügbaren Ressourcen, zeugten von seinem Verantwortungsbewusstsein für das Leben jedes Einzelnen sowie seinem Geschick, das Überleben seiner Mannschaft zu sichern. Diese Adaptionsfähigkeit spiegelte auch eine tiefere Philosophie wider, die auf der Anerkennung und Akzeptanz von Unsicherheit und Veränderung basierte. Shackletons Geschick, in der Notwendigkeit zur Anpassung eine Chance zu sehen, lehrt, dass Flexibilität und Wendigkeit Schlüsselkomponenten für den Erfolg und das Überleben in Krisensituationen sind.
Empathie
Shackleton verstand die physischen und emotionalen Bedürfnisse seiner Mannschaft und handelte stets mit dem Ziel, diese Bedürfnisse zu erfüllen und den Gruppenzusammenhalt zu stärken. Die Fähigkeit, tiefe menschliche Verbindungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, wurde zur Quelle der Führungsstärke, die es der Besatzung ermöglichte, extreme Entbehrungen zu überstehen. Shackletons Ansatz war es, das Vertrauen und den Respekt seiner Männer zu gewinnen, indem er sich als Teil der Gruppe sah, nicht als entfernter Anführer. Diese inklusive Führung half, eine Atmosphäre der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen, die wiederum entscheidend für die moralische Stärke der Expedition war.
Shackleton verstand, dass der Erfolg seiner Expedition nicht nur von seiner Führungsstärke abhing, sondern auch von der Fähigkeit jedes Einzelnen, zum Wohl der Gruppe beizutragen. Er förderte einen Geist der Gleichheit unter seinen Männern, teilte ihre Strapazen und sorgte für eine gerechte Verteilung der Aufgaben sowie der knappen Ressourcen. Diese Gleichbehandlung stärkte das Gemeinschaftsgefühl und sorgte dafür, dass sich jeder Einzelne als integraler Bestandteil des Teams fühlte. Shackletons Führungsstärke basierte auf der Überzeugung, dass das Wohl der Gruppe über dem Wohl des Individuums steht.
Entscheidungsfreude
Shackletons Entscheidung, mit nur einigen Männern in einem kleinen Rettungsboot das offene Meer zu überqueren, um Hilfe zu holen, verdeutlicht, wie entscheidungsfreudig und risikobereit er in kritischen Momenten war. Dieser Schritt war nicht nur unglaublich kühn, sondern zeugte von Shackletons tiefer Überzeugung, dass Führung Mut erfordert. Die erfolgreiche Überquerung des Südatlantiks im Rettungsboot über eine Distanz von mehr als 800 Seemeilen beweist seine Navigationskunst und die Fähigkeit, unter Druck ruhig und fokussiert zu bleiben.


Fazit
Dieses konkrete Beispiel aus den Anfängen der Polarforschung zeigt, dass die Fähigkeit zur Führung vor allem eine menschliche Qualität darstellt, die wesentlich im Charakter und in der Persönlichkeit des Führenden beheimatet ist. Charakterliche Eigenschaften, die an sittliche Normen gebunden sind, verleihen erst die wahre Legitimation zur Führung von Menschen. Der militärische Kommandant führt im Krieg Menschen unter Todesbedrohung. Fehler in der Führung können im Extremfall Tausenden das Leben kosten.
Viele militärische Führungskräfte sind hervorragend ausgebildet, vor allem operativ, taktisch, logistisch, systemisch und wehrtechnisch. Das Unerwartete verlangt eine zusätzliche Dimension des Kommandanten: die Fähigkeit zur Sinnstiftung unter extremem Druck, zur intuitiven Führung jenseits von festgelegten Prozessen und zur Achtung der Menschenwürde unter schwierigsten Verhältnissen. Diese Fähigkeiten werden nicht auf dem Truppenübungsplatz trainiert, nicht in der taktischen Hausarbeit geprüft und sind im Dienstgrad nicht sichtbar.
Doch sie entscheiden im Ernstfall über die Gefolgschaft und das Überleben von Menschen. Die Rückkehr des klassisch-konventionellen Krieges in Europa in Kombination mit Streitkräften als essenzielles Element für staatliche Souveränität verdeutlicht, dass erfolgreiche militärische Führung über diese Eigenschaften verfügen muss: Optimismus, Flexibilität, Empathie und Mut zum entschlossenen Handeln.
Oberst dG Mag.(FH) Helmut Fiedler, PhD;
Referatsleiter Führungslehre, Hauptlehroffizier und Forscher, Landesverteidigungsakademie.
Oberstleutnant dG MMag. Albin Rentenberger, MA;
Planungsoffizier Militärvertretung Brüssel.

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405)