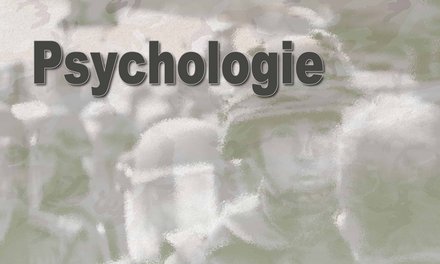Militärbezirk Enns
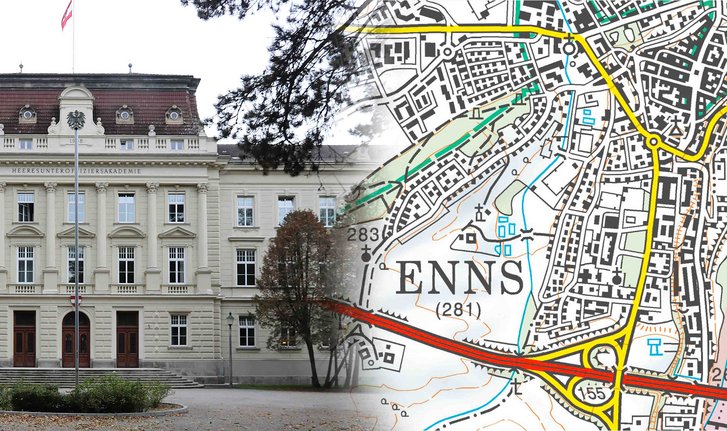
Teil 3 der Serie zur Militärgeschichte von Enns (zur Artikelserie)
Von der Pfarrgasse gelangt man zur Wiener Straße, die nach Norden zum Hauptplatz führt. Dort befindet sich das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt, der Ennser Stadtturm. Der Bau des Turmes hatte keinen militärischen, sondern zivile und repräsentative Gründe. Dennoch hatte der Turm durchaus die Aufgabe, im Bedarfsfall eine noch weitreichendere Beobachtung, als die anderen Ennser Wehranlagen zu ermöglichen. Zusätzlich beherbergte er ursprünglich den Turmwächter (auch Türmer genannt), weshalb er für die Sicherheit der Stadt als Feuerwache sehr wohl wichtig war, wenn auch nicht im militärischen Sinn.
Der Ennser Stadtturm zeugt vor allem von der einstigen Bedeutung der Stadt, die nicht nur in der Zeit der Römer ein politisches Zentrum war. So hatte der Landeshauptmann im 13. Jahrhundert hier für kurze Zeit seinen Sitz und im Jahr 1501 war sogar die Regierung der österreichischen Länder (damals Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und Krain) in der Stadt untergebracht. Der Niedergang von Enns war das Ergebnis einer kriegerischen Epoche, die im 15. Jahrhundert mit den Hussitenkriegen (ab 1420) begann und mit dem Türkenjahr 1683 endete.
Die Hussiten waren seit dem Ende der Römerherrschaft die einzige Bedrohung aus dem Norden. Sie drangen von Tschechien kommend bis zur Donau vor und überfielen mehrere Städte, wie Mauthausen. Den Fluss überschritten sie jedoch nicht, weshalb die Stadt von ihnen verschont blieb. Von 1485 bis 1488 kamen ungarische Truppen unter Matthias Corvinus bis an die Enns, wobei als Antwort auf diese Bedrohung die Mauern, Gräben und Stadttore erneuert wurden. In den Jahren 1529 waren es die Osmanen, die 1532 tatsächlich vor den Toren der Stadt standen, jedoch abgewehrt wurden und den Fluss an dieser Stelle nicht überqueren konnten. Nach einer kurzen Erholungsphase kamen ab 1610 Truppen aus Passau nach Enns und läuteten die tragischste Epoche der Stadt ein, die ihren Niedergang bedeutete. Der Dreißigjährige Krieg, währenddem nicht nur auf dem Georgenberg, sondern auch im ehemaligen Legionslager Schanzen angelegt wurden, war mit dem Durchzug und der Einquartierung tausender Soldaten verbunden, obwohl es in Enns grundsätzlich zu keinen Kampfhandlungen kam. Dennoch wurde Enns im Zuge der Bauernkriege 1626 belagert.

Für Enns bedeutete diese Belagerung die umfangreichste Zerstörung, die die Stadt jemals erleben musste. Ein Drittel der Häuser war zerstört, der Handel und das Gewerbe kamen zum Erliegen. Die zahlreichen Einquartierungen von Truppen (bis zu 10.000 Mann), die es bereits davor gab, fanden in dieser Epoche ihren Höhepunkt. Sie verhinderten den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung der Stadt, die durch die Vertreibung der Protestanten zusätzlich geschwächt wurde. Im Jahr 1683 folgt der nächste Rückschlag, als die Stadt abermals Truppen aufnehmen musste und Enns erneut zu einer großen Kaserne wurde.
Die Einquartierungen bedeuteten nicht nur, dass die Häuser in Enns Ort voller Soldaten und Heeresgefolge waren, sondern auch dass die Stadtbewohner diese zu verpflegen hatten. Neben der Versorgung fremder Truppen und der Sicherung des eigenen Vermögens waren damals alle anderen Arbeiten beinahe unmöglich. Es gab kaum landwirtschaftliche Tätigkeiten und nur ein minimales Handels- und Wirtschaftsleben. Ersparnisse sowie andere Wertgegenstände oder Güter mussten oft veräußert werden, wenn sie nicht davor bereits geplündert oder geraubt worden waren. Für die Bevölkerung machte es kaum einen Unterschied, ob eigene oder fremde Soldaten im Ort waren, da sich de facto alle wie Besatzer verhielten. Die feindlichen Heerscharen töteten, vergewaltigten, raubten und plünderten jedoch ungleich häufiger als die eigenen Truppen.
Neben dem Stadtturm befindet sich das Museum Lauriacum. Dieser Ort der Kulturvermittlung besteht seit dem Jahr 1892 und war der Mittelpunkt der Oberösterreichischen Landesausstellung 2018 (TD-Artikel: Gekommen, um zu bleiben). Der Schwerpunkt des Museums liegt auf der Darstellung der römischen Epoche. Daneben werden auch andere Zeitabschnitte thematisiert und Sonderausstellungen durchgeführt, wie „EnnsBrücke 1945. Dokumente – Fotos – Zeitzeugen“ (TD-Artikel: Die längste Brücke der Welt), die das Ende des Zweiten Weltkrieges und die darauffolgende Besatzungzeit in den Fokus rückt (TD Link einfügen).
Nach dem Besuch des Museums Lauriacum geht die militärhistorische Reise in die nächste Schleife – in den Süden und Westen der Stadt mit seinen zahlreichen militärhistorisch relevanten Stätten. Entlang der Wiener Straße bietet sich ein Abstecher zur Ennser Pfarrkirche St. Marien an. Neben dieser befindet sich, neben dem Denkmalensemble bei der Lorcher St. Laurenz-Basilika, das zweite Kriegerdenkmal der Stadt. Dieses modern gestaltete Gedenkzeichen erinnert an die Ennser Gefallenen, die auf den Schlachtfeldern des Ersten und Zweiten Weltkrieges starben. Ihre Namen sind im Gegensatz zu vielen anderen Soldaten-Gedenkstätten in Österreich nicht am Denkmal, sondern in einem Totenbuch verewigt, das an dessen Rückseite in einem Fach versperrt ist.
Neben der Pfarrkirche steht das Franziskanerkloster, dessen frei zugänglicher Kreuzgang über eine Tür neben dem Westtor der Kirche betreten werden kann. Das Kloster wurde zwar unter Joseph II. (1741 bis 1790) aufgelassen, beherbergt heute jedoch wieder Mönche, die in Enns als Seelsorger tätig sind. In dem Kreuzgang des Klosters befindet sich eine Tafel für Franz Jägerstätter, der als Wehrdienstverweigerer vom NS-Regime zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.
Der 2007 seliggesprochene Jägerstätter gilt in der römisch-katholischen Kirche als Märtyrer und ist neben Schwester Restituta das bekannteste Symbol des klerikalen Widerstandes gegen das NS-Regime in Österreich. Er war zwar kein Ennser, sondern kam aus St. Radegund im Innviertel, rückte jedoch zweimal in die heutige Towarek-Schulkaserne ein. Beim ersten Einrücken wurde er aus wirtschaftlichen Gründen (er war Landwirt) freigestellt, beim zweiten Mal wurde darauf nicht mehr Rücksicht genommen, woraufhin er den Militärdienst für das NS-Regime verweigerte. Jägerstätter wurde in seinem Kasernenzimmer verhaftet, nach Linz gebracht und nach Berlin überstellt. Nach seiner Verurteilung zum Tode, wurde er am 9. August 1943 durch das Fallbeil hingerichtet.
Nach dem Besuch des Kriegerdenkmales, bzw. des Franziskanerklosters geht es zur Wiener Straße und zu jenem Punkt, an dem sich früher das südliche Stadttor befand. Heute ist in diesem Bereich ein Parkplatz, hinter dem Reste der Ennser Stadtmauer erkennbar und somit auch die ehemaligen Steine des Legionslagers zu sehen sind. Beim Kreisverkehr befindet sich an diesem, heute als Stützmauer verwendeten Teil der ehemaligen Befestigung, das Denkmal für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este. Dieser leistete nicht nur seinen Militärdienst (der als Mitglied des Hauses Habsburg obligatorisch war) in Enns ab, er war später auch General der Kavallerie und der letzte Inhaber des Ennser Dragonerregimentes Nr. 4.
Das Denkmal befindet sich an der ehemaligen Reichsstraße, der späteren Bundesstraße 1, die heute als Umfahrung den Verkehr nördlich an der Stadt vorbeiführt. Die Trasse dieser, bis zur Eröffnung der Eisenbahn und später der Autobahn, wichtigsten West-Ost-Verbindung Österreichs nördlich der Alpen verläuft entlang einer Verkehrsader, die seit Jahrtausenden existiert. Sie bestand vermutlich bereits bevor die Römer kamen, die neben der zivilen auch eine militärische Straße anlegten, die für das rasche Verschieben von Truppen reserviert war. Seit der Antike hat diese Verkehrsader beinahe alle wesentlichen Militäroperationen und Feldzüge erlebt, bei denen die Stadt Enns aufgrund ihrer Lage am Ennsfluss eine Rolle spielte.
Eine dieser Militäroperationen fand im März 1938 mit dem Anschluss von Österreich an NS-Deutschland statt. Dieser wird in der aktuellen Zeitgeschichteforschung als Anschluss von oben, von unten und von außen angesehen. „Von oben“ bedeutet einerseits die Hinwendung einflussreicher gesellschaftlicher Eliten zum Nationalsozialismus sowie das Einsetzen von NS-Ministern in die österreichische Regierung. Als „von unten“ wird der Druck der Straße, der von örtlichen NS-Führern organisiert wurde und von einem Teil der Bevölkerung in Form von Demonstrationen, Aufmärschen etc. im März 1938 getragen wurde, verstanden. Als Anschluss „von außen“ wird die Militäroperation, der Einmarsch der deutschen Truppen am Land und in der Luft, bezeichnet.
Was vielen heute nicht bekannt ist, ist die Tatsache, dass das Bundesheer einen militärischen Plan „in der Schublade hatte“, der die zeitlich begrenzte Verteidigung der Republik Österreich vorsah. Dieser wurde von Feldmarschall Alfred Jansa ausgearbeitet, weshalb er auch als „Jansa-Plan“ bezeichnet wird. Dabei wollte man mit einer zeitlich begrenzten Verteidigung an der Grenze und dem Verzögerungskampf der Deutschen Wehrmacht den Einmarsch möglichst schwermachen. Das entscheidende Gelände dieses Planes war der Raum um den Fluss bzw. die Stadt Enns. Dort hätte die Masse des Österreichischen Bundesheeres der Deutschen Wehrmacht die Stirn bieten sollen, wozu es bekanntlich nicht kam.

Im Zweiten Weltkrieg war der Raum östlich von Enns jener Bereich, in dem der Krieg endete und wo amerikanische und sowjetische Soldaten aufeinandertrafen, wobei der Ort des ersten Treffens sehr wahrscheinlich Strengberg war. Doch bevor der Krieg an der Enns endete, erreichte in der Endphase 1945 die nationalistische Vernichtungspolitik eine weitere Stufe - auch bzw. vor allem in diesem Raum in der Nähe des Konzentrationslagers Mauthausen. Zigtausende, zumeist ungarische Juden, wurden in Todesmärschen in das Konzentratrionslager Mauthausen getrieben bzw. von dort weiter Richtung Westen, beispielsweise nach Gunskirchen. Die Hauptroute westlich der Enns war erneut die ehemalige Reichsstraße/Bundesstraße 1 - heute Österreichische Romantikstraße. An das Schicksal dieser Menschen erinnert das Denkmal für die Opfer der Todesmärsche, das im Oktober 2022 bei der Kreuzung Wiener Straße/Österreichische Romantikstraße errichtet wurde.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges markierte der Fluss für zehn Jahre die Grenze zwischen dem westlich-marktwirtschaftlichen und dem östlich-kommunistischen Machtblock, in den die Welt bis Ende der 1980er-Jahre geteilt war. Auch nach dem Abzug der Besatzungstruppen behielt der Ennser Raum im Kalten Krieg seine militärstrategische bzw. operative Bedeutung, obwohl er in der Raumverteidigung keine Rolle gespielt hätte. Währenddessen war das entscheidende Gelände der Bezirk Amstetten, also westlich der Enns und somit erneut vor der Haustüre der Stadt.
Etwa 150 m südlich des Kreisverkehrs mit dem Denkmal für den Thronfolger Franz Ferdinand von Österreich-Este befindet sich gegenüber einer Tankstelle in der Forstberggasse die ehemalige Reithalle der Winterreitschule des Dragonerregimentes 4. Dieser Kavallerieverband hatte südlich dieser Halle einst seine Kaserne, die 1983 abgerissen wurde und Wohngebäuden weichen musste. Die ehemalige Winterreitschule wurde in den letzten Jahrzehnten für unterschiedliche Zwecke, von Reitvorführungen über Autoausstellungen oder als Ort für die Ausmusterung der Unteroffiziere des Bundesheeres, temporär verwendet. Seit dem Jahr 2015 wird sie unter anderem als Verkaufsfläche für Handelsketten oder für Kulturvereine genutzt.
Gegenüber der Kavalleriekaserne wurde zwischen 1906 und 1908 die Militärunterrealschule errichtet, in der sich ständig etwa 160 Zöglinge auf ihre Offizierskarriere vorbereiteten. Heute ist diese militärische Liegenschaft als Towarek-Schulkaserne und als Heeresunteroffziersakademie (HUAk) bekannt, die Heimat der österreichischen Unteroffiziere. Bevor sie zu dieser wurde, war sie bereits in den 1930er-Jahren sowie von 1956 bis 1958 die Militärakademie des Bundesheeres. Dazwischen wurde die Liegenschaft von der Wehrmacht, der U.S. Army und der B-Gendarmerie, dem Vorläufer des Bundesheeres der Zweiten Republik, genutzt. Die Towarek-Schulkaserne kann nicht besucht werden, da sie als militärische Liegenschaft genutzt wird. Ein Blick durch den Kasernenzaun bietet jedoch die Möglichkeit, sich einen Eindruck über diesen Bau zu verschaffen.
In dieser Kaserne befinden sich mehrere Kleindenkmäler, die teilweise von außen zu erkennen sind. Das erste ist der Gedenkstein für Generaloberst Rudolf Towarek im Eingangsbereich der militärischen Liegenschaft. Towarek war der Kommandant der Ennser Militärakademie im Jahr 1938, die im selben Jahr – ebenfalls unter seiner Führung – nach Wiener Neustadt verlegt wurde. Sein Name ist eng mit dem Widerstand gegen den Anschluss bzw. das NS-Regime verbunden, da er die Inbesitznahme der Wiener Neustädter Militärakademie durch die Nationalsozialisten so lange wie möglich verhinderte. Dabei ließ er die Offiziersanwärter sogar mit aufgepflanztem Bajonett gegen die Eindringlinge vorgehen. Auch wenn der „berühmte Schuss“ damals nicht fiel, leistete das Bundesheer unter diesem Offizier dennoch – wenn auch symbolisch und lokal begrenzt – militärischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Auf dem Platz zwischen dem Akademiepark und dem Hauptgebäude der Heeresunteroffiziersakademie befindet sich der Gedenkstein für Robert Bernardis. Auch dieser thematisiert den bewaffneten Widerstand gegen das NS-Regime durch einen Offizier. Oberstleutnant im Generalstab Robert Bernardis war einer der Köpfe der Operation Walküre, dem misslungenen Militär-Putsch gegen das NS-Regime im Jahr 1944, im Zuge dessen Oberst Stauffenberg einen Sprengstoffanschlag auf Hitler in dessen Hauptquartier Wolfsschanze verübte. Bernardis ist nicht nur ein Symbol des Widerstandes, sondern auch von soldatischen Tugenden. Er informierte seine Mitverschwörer über das Scheitern der Operation, wodurch er sich selbst verriet, vielen seiner Kameraden jedoch das Leben rettete. Am 8. August 1944 wurde er zum Tode verurteilt und noch am selben Abend gehängt.
Neben diesen beiden Offizieren ist bei der Eingangstüre der Severin-Kapelle der Towarek-Schulkaserne eine Gedenktafel für Franz Jägerstätter angebracht. Zusätzlich gibt es im Hauptgebäude einen Lehrsaal, der nach Feldwebel Anton Schmid, einem Wiener Unteroffizier der Wehrmacht, benannt ist. Schmid versah Dienst im Ghetto von Vilnius und rettete zahlreiche Juden vor dem sicheren Tod, bevor er verraten und selbst zum Opfer des NS-Regimes wurde, das ihn hinrichtete. Sowohl Schmid als auch Bernardis erhielten im Jahr 2020 eine posthume Ehrung, als die Rossauer Kaserne, der Sitz des Bundesministeriums für Landesverteidigung, den offiziellen Namen „Amtsgebäude Rossau Bernardis-Schmid“ erhielt.
Der Beginn der Ennser Garnison war jedoch – abgesehen von der römischen Legion bzw. eines möglichen früheren Stützpunktes am Georgenberg oder den Truppen, die in der Stadt einquartiert waren – im Schloss Lerchenthal in der Steyrerstraße. Dieses kann man von der Towarek-Schulkaserne über die Forstbergstraße sowie einen Fußpfad erreichen. Im Schloss Lerchenthal fanden während des österreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1741 die ersten fixen Einquartierungen statt, als dort bairische und französische Truppenteile untergebracht waren. Dieser Feldzug war der erste Kontakt mit französischen Truppen in Österreich, die ein paar Jahrzehnte später während der Napoleonischen Kriegen (1796 bis 1814) mehrere Male nach Österreich kamen.
Im Jahr 1845 wurde das Schloss Lerchenthal offiziell zur Kavalleriekaserne. In weiterer Folge wurde es bis zum Abzug der Truppen der U.S. Army aus dieser Kaserne im Jahr 1947 militärisch verwendet. Die Gebäude wurden ab 1950 von Sudetendeutschen Flüchtlingen aus Gablonz genutzt (siehe Denkmal im Schlosspark), die auch ihr Wissen über die Schmuckerzeugung in ihre neue Heimat mitbrachten und die Ennser Schmuckmanufaktur, die sich neben der ehemaligen Kaserne befindet, gründeten. Dort wird heute der traditionelle Gablonzer Schmuck aus der sudetendeutschen Heimat ihrer Vorfahren hergestellt. Neben der Lerchenthal-Kaserne waren auch in der ehemaligen Kavalleriekaserne bei der Winterreitschule Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges untergebracht.
Über die Schleife, bei der man den ehemaligen Kasernenbezirk von Enns kennenlernt, gelangt man über die Steyrer Straße zurück zur ehemaligen Bundesstraße. Von diesem Kreuzungsbereich aus kann man den Ledererturm, den fünften noch erhaltenen Turm, der ein Teil der mittelalterlichen Ringmauer war, erkennen. Von dieser Kreuzung gelangt man Richtung Nordwesten auf den Weg zum Ausgangspunkt. Aber auch hier empfiehlt es sich, nicht den kürzesten Weg zu wählen, sondern bei der Doktor-Renner-Straße nach Westen abzubiegen und einen Abstecher zum Eichberg zu unternehmen. In dem Wald beim Eichberg befindet sich bei einer Kreuzung am Waldeingang das Bauernkriegsdenkmal, das an jene Epoche erinnert, die für die Stadt Enns und ihre Bevölkerung Elend, Not, Zerstörung und den wirtschaftlichen Niedergang bedeutete.
Die Bauernkriege des Jahres 1626 fanden während des Dreißigjährigen Krieges statt und richteten sich gegen die damalige bayrische Besatzung von Oberösterreich (bayrische Pfandherrschaft von 1620 bis 1628). Ein Hintergrund dieser Auseinandersetzung war der Umstand, dass Oberösterreich damals weitgehend protestantisch, Bayern jedoch katholisch war. Unter der Führung des Bauernführers Stefan Fadinger begann damals eine bewaffnete Revolte, die nach anfänglichen Erfolgen von den Bayern und den Habsburgern niedergeschlagen wurde.
Enns, das noch kurz davor von der Pest betroffen war, wurde – so wie andere oberösterreichische Städte (Steyr oder Linz) auch – von aufständischen Bauern belagert, die am Eichberg ihr Lager hatten und dieses auch mit Schanzen befestigten, deren terrassenartige Anlage noch heute hinter dem Bauernkriegsdenkmal zu erkennen ist. Die Belagerer versuchten jeglichen Güter- und Personenaustausch zu unterbinden und beschossen die Stadt vom Eichberg aus. Enns wurde dabei hart getroffen, wovon einige im Museum Lauriacum ausgestellte Kanonenkugeln zeugen. Letztendlich war die Belagerung, die einen Monat (vom 24. Juni bis 23. Juli 1626) dauerte, genauso erfolglos wie der gesamte Bauernkrieg. Am 23. Juli 1626 übersetzten kaiserliche Truppen die Enns aus dem Osten und am Tag darauf kam es zum Kampf am Eichberg. Die Bauern wurden geschlagen und ihr Anführer, Wolf Wur, im Jahr 1627 in Linz gevierteilt und enthauptet. Sein zerrissener Körper wurde danach am Eichberg, sein abgeschlagener Kopf am Ennser Stadtturm, als abschreckendes Beispiel, zur Schau gestellt.
Der Eichberg sollte auch im letzten Krieg, der Österreich erschütterte, eine Rolle für die Stadt spielen. Neben einem Munitionslager, das sich in dem Wald befand, gab es dort auch einen Luftschutzstollen, der sich etwa 300 m nordwestlich des Denkmales für die Bauernkriege befindet. Dieser Stollen existierte zwar bereits vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde währenddessen jedoch auch für den Luftschutz verwendet und ist somit ein Zeuge des Bombenkrieges. Enns selbst war zwar kein Ziel alliierter Bomberverbände, sehr wohl aber die benachbarten Städte Linz, Steyr, Amstetten und St. Valentin mit dem Nibelungenwerk (TD-Artikel: Panzer aus der „Spielwarenfabrik“).
Vor dem Stollen steht ein Gedenkstein auf der freien Fläche, der an ein Endphaseverbrechen des NS-Regimes erinnert. Am 5. Mai 1945, dem letzten Tag des Zweiten Weltkrieges in Enns, war der Eichberg der Ort einer Massenerschießung von Deserteuren durch die SS. Obwohl in Linz bereits die U.S. Army war, die am Abend auch die Stadt Enns erreichen sollte, wurden noch am Nachmittag dieses Tages 59 Wehrmachts-Deserteure standrechtlich erschossen.
Nach diesem letzten Ort führt der Streifzug durch die militärhistorisch relevanten Stätten der Stadt Enns nun endgültig zurück zum Ausgangspunkt. Die besuchten Plätze führten zu den Römern, Karl den Großen, den Ungarneinfällen, in das Mittelalter, zu Matthias Corvinus, den Türkeneinfällen, den Bauern- und Glaubenskriegen, über den Dreißigjährigen Krieg, die Erbfolgekriege, die Feldzüge Napoleons bis zum Zweiten Weltkrieg. Sie zeigen, dass Enns vermutlich jener Ort in Österreich ist, der die meisten kriegerischen Ereignisse in Österreich „sah“. Die Stadt war Durchzugs- und Kampfgebiet, aber auch ein Grenzort, der mit Eroberungen, Aufständen, Feldzügen und kriegerischen Handlungen aus Ost, West, Nord und (manchmal) Süd konfrontiert war und damit im Zentrum des Fadenkreuzes der österreichischen Militärgeschichte lag.
Hofrat Gerold Keusch, BA MA; Leiter Online-Medien bei der Redaktion TRUPPENDIENST.