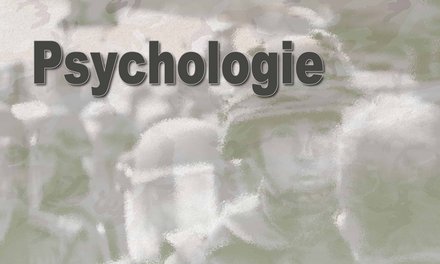Ukraine-Krieg Phase 8

Im Juni 2025 überschlugen sich die Ereignisse in der Ukraine. Initialzündung war die Operation „Spiderweb“, der ukrainische Drohnenangriff auf russische Flugplätze. In der Zwischenzeit geht der Krieg an der Front weiter, wo die russischen Streitkräfte langsam, aber stetig Geländegewinne erzielen.
Der Ukraine-Krieg ist aktuell (Stand: Juli 2025) in der Phase 8, der dritten Sommeroffensive. Neuerlich sollen die russischen Truppen die Verteidigungslinien der Ukraine durchstoßen und einen operativen Durchbruch erzielen. Diese mittlerweile vierte ukrainische Verteidigungslinie wurde in der Tiefe eingerichtet, teilweise hinter den von der russischen Seite in der Phase 7 durchbrochenen Linien. Die Phase 7 im Sommer/Herbst 2024 war davon geprägt, dass die russischen Kräfte das Momentum – die Initiative – zurückgewinnen konnten, wenngleich es ihnen nicht gelungen ist, in der Mitte der Front einen Durchbruch zu erzielen, weil die ukrainischen Verteidiger dagegenhielten.
Um die russische Kriegsführung zu verstehen, ist ein Blick in die ihr zugrundeliegende Philosophie erforderlich. Die aktuelle russische Militärtheorie und die darauf basierenden Doktrinen werden bis heute von Denkern der Vergangenheit geprägt. Einer davon ist General Alexander Svetschin (1878 bis 1938), der Autor des Werkes „Strategie“. Eine seiner Grundaussagen lautet, dass man einen langen Abnutzungskrieg führen muss, wenn es nicht gelingt, am Beginn eines Krieges durch ein schnelles Manöver ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Wenn man die Schriftstücke von Walerij Gerassimow betrachtet, dem Chef des Generalstabes der Streitkräfte Russlands und Oberbefehlshaber der russischen Truppen im Ukraine-Krieg, oder die Inhalte, die in den Social-Media-Kanälen Russlands diskutiert werden, erkennt man, wie allgegenwärtig diese Denkweise ist.
Phase 8
Um die aktuellen Entwicklungen der Phase 8 umfassend darzustellen, wird diese auf der strategischen, operativen und taktischen Ebene betrachtet.
Strategische Ebene
Auf der strategischen Ebene ist es nach wie vor das Ziel Russlands, die Kritische Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Diesen Plan verfolgen die russischen Streitkräfte mit der bereits bekannten Angriffskombination aus Drohnen und Marschflugkörpern (siehe TD-Heft 2/2025). Die Anzahl dieser Angriffe nimmt konstant zu, insbesondere jene mit Drohnen.
Die Voraussetzung dafür ist die massive Steigerung der russischen Drohnenproduktion mit Spitzen von täglich bis zu über 700 Stück. Dabei handelt es sich vor allem um „Geran-2“-Drohnen, die aufgrund ihrer Verfügbarkeit mit zunehmender Zahl eingesetzt werden und die ihre Ziele präzise treffen können. Ein Beispiel ist das Antonow-Werk in Kiew, das bei einem Luftangriff im April 2025 schwer beschädigt wurde.
Die Ukraine wehrt sich und führt ebenfalls eine strategische Luftkampagne gegen Russland durch, wobei sie mit Drohnen unter anderem Ziele in der Tiefe bekämpft. Beeindruckend war in diesem Zusammenhang vor allem die Operation „Spiderweb“, der Angriff auf die strategische Luftflotte Russlands durch den Sicherheitsdienst der Ukraine.
Operation „Spiderweb“
Am 1. Juni 2025 gelang der Ukraine eine bemerkenswerte militärische Operation. Durch eine Aktion des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) im Hinterland Russlands wurden ukrainischen Angaben zufolge fünf russische Militärflugplätze – bis zu 4 000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – durch ukrainische Drohnen angegriffen und sieben Tu-95 und vier Tu-22 strategische Bomber zerstört sowie zwei Tu-95, zwei Tu-22, zwei weitere Frühwarn- und ein Transportflugzeug beschädigt.
Ukrainische Agenten haben in 18 Monaten Vorbereitungszeit Drohnenteile über Kasachstan nach Russland geschmuggelt, diese in der Stadt Tscheljabinsk in einer alten Werkstätte zusammengebaut und in weiterer Folge in den Dächern mehrerer Container versteckt, gelagert. Diese Container wurden dann auf mehrere LKW verladen, die in die Nähe (maximal zehn Kilometer entfernt) von sechs russischen Militärflugplätzen fuhren, ohne dass die LKW-Fahrer von ihrer Fracht wussten:
- Belaja (ca. 85 km nordwestlich von Irkutsk);
- Djagilewo (ca. 200 km südöstlich von Moskau);
- Iwanowo (ca. 250 km nordöstlich von Moskau);
- Woskressensk (ca. 80 km südostwärts von Moskau);
- Olenja (ca. 1 400 km nördlich von Moskau bei Murmansk);
- Ukrainka (ca. 5 500 km von Moskau entfernt, bei Amur im Fernen Osten Russlands), wenngleich der dortige Angriff fehlschlug.
Nachdem die Fahrzeuge dort abgestellt worden waren, starteten etwa 150 Drohnen ihre Angriffe auf die strategischen Bomber. Die Drohnen sollen unter Nutzung des russischen GSM-Netzes mit einer Auto-Homing-Funktion nach Voreingabe der Koordinaten in Richtung der Flugplätze geflogen sein. Dort haben sie KI-unterstützt die Flugzeuge aufgrund ihrer Konturen als Ziele erkannt, sich auf diese gestürzt und getroffen.
Zur Vorprogrammierung wurden alte Zellen dieser Bomber, die aus der Sowjetzeit stammen und im ukrainischen Poltawa in einem Freiluftmuseum stehen, genutzt. Anhand dieser wurde die KI-Software trainiert, die in die Drohnen eingespielt wurde. Das Ergebnis ist nicht nur spektakulär, sondern auch deshalb ein großer und nachhaltiger Erfolg, da diese Flugzeuge vermutlich für einen größeren Angriff vorbereitet und kurz davor mit Marschflugkörpern beladen worden waren.
Die strategische Luftflotte Russlands verfügt über etwa 100 Flugzeuge der Typen (Tupolew) Tu-160, Tu-95 sowie Tu-22. Von diesen wurden und werden Marschflugkörper sowie Langstreckenraketen auf die Ukraine abgefeuert. Der Klarstand betrug Ende Mai etwa 50 Flugzeuge, von denen eine signifikante Anzahl sowie zwei eingemottete Frühwarnflugzeuge vom Typ Berijew A-50 getroffen wurden.
Somit konnte die Ukraine einen bedeutenden Teil der verfügbaren russischen Bomberflotte ausschalten und der russischen Luftwaffe einen schweren Schlag zufügen. Hinzu kommt, dass diese schweren Bomber (vor allem die TU-160) ein Teil der „nuklearen Triade“ sind, des nuklearen Droh- und Abschreckungspotenzials Russlands, die damit ebenfalls geschwächt wurde. Es ist bemerkenswert, dass kein Tu-160 angegriffen wurden.
Die getroffenen russischen Flugplätze waren durch Fliegerabwehrwaffen von mittlerer und hoher Reichweite gesichert. Mit dem Angriff kleiner Drohnen hat man nicht gerechnet, weshalb man diese nicht bekämpfen konnte, obwohl es in der Vergangenheit bereits Einflüge solcher Drohnen gegeben hatte. Somit ermöglichte eine falsche russische Beurteilung der Lage des Gegners und seiner Kapazitäten diesen Angriffserfolg. Das gilt ebenfalls für den halbherzigen Versuch, die Flugzeuge durch Autoreifen auf den Tragflächen vor Drohneneinschlägen zu schützen, bzw. damit die KI-Erkennung zu erschweren.
Ein Blick in die Militärgeschichte zeigt, dass es bereits früher ähnlich spektakuläre Aktionen gab. Beispiele sind der Angriff der britischen Royal Air Force auf die italienische Marine in Tarent im Jahr 1940, der Angriff japanischer Flugzeuge auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor im Dezember 1941 oder der Angriff der deutschen Luftwaffe 1944 auf Poltawa (in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine) auf dort abgestellte US-Bomber.
Die erfolgreiche Operation „Spiderweb“ wird das Aufrechterhalten der Intensität der Luftangriffe auf die Ukraine für die Russen deutlich erschweren. Bemerkenswert ist, dass es möglich war, mit Kleindrohnen die strategische Luftwaffe der Russen nicht nur anzugreifen, sondern sogar empfindlich zu treffen. In jedem Fall hat die Ukraine mit diesem sorgfältig geplanten und wirkungsvollen Angriff auf die wichtigsten russischen Flugplätze der strategischen Bomberflotte Geschichte geschrieben. Vor allem durch die Art und Weise, in welcher dieser durchgeführt wurde.

Operative Ebene
Russland hat versucht, eine Kriegswende durch einen operativen Durchbruch im Zentralraum bzw. im Mittelabschnitt der Front zu erzielen. Dieser ist aber bis jetzt nicht gelungen. Die Ukraine hat ihre Verteidigungsstellungen laufend ausgebaut, die die Russen im Nord-, Mittel- und Südabschnitt auch weiterhin massiv angreifen. Offensichtlich versuchen die russischen Streitkräfte, die ukrainischen Verteidigungsstellungen endgültig zu durchbrechen.
Dabei greifen sie nicht nur frontal an, sondern versuchen auch im Norden und im Süden, einen raschen und massiven Durchbruch zu erzielen, um so hinter die ukrainischen Stellungen zu gelangen. Ob das gelingt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Solange die Ukraine dagegenhalten kann, ist dies aber unwahrscheinlich. Sehr wohl erfolgt aber eine Bindung wichtiger ukrainischer Reserven, was die Situation im Mittelabschnitt laufend verschärft.
ang, dass die russische Rüstungsproduktion auf Hochtouren läuft. So werden immer öfter Bilder von neu produzierten Panzern gezeigt, die zwar aus den Werken rollen, aber nicht an die Front kommen. Damit stellt sich die Frage, ob Russland eine größere Offensivhandlung vorbereitet. Diese Aufnahmen sind jedenfalls konträr zu den Bildern von umgebauten russischen Autos (auch als Buchankas und Schigulis bezeichnet), die für den Fronteinsatz improvisiert verwendet werden.
Die russischen Angriffe erfolgen in Phasen. Die russischen Truppen versuchen im Erstansatz, die ukrainischen Soldaten in ihren Stellungssystemen mit Gleitbomben, Artillerie und Reizstoffen zu zermürben. Hinzu kommt der laufende Einsatz von Aufklärungs- und Angriffsdrohnen. In diesem Fähigkeitsbereich haben die Russen mittlerweile die Oberhand gewonnen, obwohl Drohnen von beiden Seiten massiv eingesetzt werden. Mit First-Person-View-Drohnen werden immer häufiger einzelne Soldaten gejagt. Ihre Stellungen werden zunächst – ebenfalls von Drohnen – aufgeklärt, dann werden die dortigen Schützen bzw. ihre Waffensysteme gezielt angegriffen. Aufgrund der Störmaßnahmen im elektromagnetischen Raum geschieht das mittlerweile vor allem durch drahtgesteuerte Drohnen.
Um den Druck auf ihre Stellungen zu verringern, versuchen die ukrainischen Verteidiger, die russischen Angriffsanstrengungen umzuleiten. Das machen sie einerseits durch Gegenangriffe und Übertritte auf das russische Territorium. Andererseits versuchen sie, den Gegner auf eigenem Boden abzunutzen, indem sie zurückweichen und diesen immer wieder in neue Stellungen laufen lassen.
Die Ukraine hat erkannt, dass sie vor allem die Militärlogistik der Russen unterbrechen muss. Beispiele dafür sind die Sprengungen von Brücken entlang einer wichtigen Eisenbahnline, die für die laufende russische Offensive im Raum Sumy bedeutend sind, oder die immer wieder versuchte Sprengung der Brücke von Kertsch. Durch solche Zerstörungen kann die russische Militärlogistik verzögert werden, was sich wiederum negativ auf die russische Einsatzführung auswirkt.
Taktische Ebene
Auf der taktischen Ebene ist es nach wie vor das Ziel der russischen Streitkräfte, die ukrainischen Verbände entlang der gesamten Front durch möglichst viele Angriffe zu binden und einen Durchbruch zu schaffen, wo immer dies möglich ist. Die Ukraine ist somit in einem zermürbenden Stellungskrieg gefangen. Mittlerweile hält sie oft nur noch Stützpunkte und keine durchgehenden Stellungen, teilweise mit einer geringen Anzahl an Soldaten, die häufig weit voneinander entfernt sind, wenngleich diese in Kombination mit Drohnen derzeit ausreichen, um einen russischen Durchbruch zu verhindern.
Die russische Seite schafft es, durch leichte und mobile Kräfte – unter hohen Verlusten – mittlerweile häufig, erfolgreich durchzubrechen. Diese Situation gibt es entlang der gesamten Front. Jeden Tag nehmen die russischen Truppen etwa 15 bis 20 km² Territorium ein. Von Mai bis Juli waren das mehr als 1 700 km². Manchmal gelingt den Ukrainern zwar ein Gegenangriff mit begrenztem Gebietsgewinn, insgesamt rücken die Russen aber Schritt für Schritt weiter Richtung Westen vor.
Typisch für die Angriffe der russischen Seite, die sich seit Wochen täglich wiederholen, ist das folgende Szenario: Leichte mobile Kräfte auf Motorrädern klären auf und erkennen Lücken in den ukrainischen Stellungssystemen. Auf diese werden russische Angriffsgruppen mit Kampf- und Kampfschützenpanzern angesetzt. Diese führen ein so genanntes „Panzerkarussell“ durch. Dabei fährt ein Minenräumpanzer voraus, während der Rest folgt.
Die ukrainischen Verteidiger versuchen, die Angreifer durch Minen und Artillerie aufzuhalten, während russische Infanterie aus einer Kreisbewegung heraus absitzt, um ein Stück Gelände in Besitz zu nehmen. Dabei laufen die Soldaten in Minenfelder und/oder werden weiterhin von der ukrainischen Artillerie beschossen oder durch Drohnen angegriffen. Die Panzer versuchen wieder auf der geräumten Spur zurückzufahren. Nur wenigen gelingt dies.
Die russische Taktik ist nicht neu. Die Sowjets hatten z. B. im Zweiten Weltkrieg eigene Motorradaufklärungsbataillone, die ihren Panzerverbänden vorausfuhren oder sie bei der Sicherung der Flanken oder der Verfolgung fliehender feindlicher Truppen unterstützten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Motorräder sind leichter, schneller und vor allem wendiger als Autos oder Panzer.
Eine interessante Tatsache ist, dass Stacheldrahthindernisse derzeit eine der wirkungsvollsten Abwehrmaßnahmen sind, vor allem in der vierten ukrainischen Verteidigungslinie. Die russischen Kräfte schaffen es zwar, mit ihren kleinen, leichten und mobilen Kräften zu Fuß oder auf Motorrädern zwischen den ukrainischen Stützpunkten „einzubrechen“. Dort bleiben sie jedoch im Stacheldraht hängen, wo sie Opfer der ukrainischen Drohnen werden, wodurch ihr Vorstoß schließlich abgewehrt wird. Mittlerweile gibt es Fahrzeuge, die dafür ausgestattet sind, Stachelbandrollen im Schnellverfahren zu verlegen.
Lage an der Front
Für ein Verständnis der aktuellen Lage an der Front ist es günstig, ausgewählte Abschnitte des Geschehens zu betrachten. Das sind der Nordabschnitt bei Sumy sowie die Städte Wow-tschansk und Pokrowsk.
Nordabschnitt
Nach der erfolgreichen Beendigung der Kursker Operation haben die russischen Truppen den Vormarsch Richtung Sumy fortgesetzt. Dieser Vorstoß kann als Teil der beginnenden russischen Sommeroffensive angesehen werden. Die ukrainischen Kräfte waren zunächst gezwungen, zurückzuweichen und einige Ortschaften zu evakuieren. Nun versuchen sie, diesen Vorstoß aufzuhalten. Dabei kommt es zum Einsatz kampfkräftiger Elemente, welche die russischen Einheiten vor allem mit Drohnen angreifen, um so deren Vormarsch zu stoppen.
Wowtschansk
Zwischen Charkiw und Kupjansk haben die russischen Angriffsanstrengungen bei Wowtschansk erneut an Schwung gewonnen. Mit dem Einsatz von Artillerie versuchen die Russen dort vorzustoßen. Zusätzlich ist es ihnen bei Kupjansk gelungen, mehrere Brückenköpfe zu bilden, wo ebenfalls ein russischer Vorstoß zu erwarten ist, um der Ukraine ein größeres Stück ihres Gebietes herauszubrechen.
Pokrowsk
Zwischen Pokrowsk und Tschassiw Jar entstehen im Mittelabschnitt derzeit zwei Kessel – einer zwischen Pokrowsk und Nowo Poltawka, der andere zwischen Nowo Poltawka und Tschassiw Jar. Dort dürften die russischen Verbände den Plan verfolgen, vor allem durch den Einsatz von weitreichenden, glasfasergesteuerten Drohnen zuerst die ukrainische Versorgung abzuschneiden, um dann mit Angriffen auf dem Boden die Kesselbildung zu ermöglichen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, wie weit die russischen Truppen dort vordringen können. Das Schwergewicht ist im Moment der Vorstoß im Mittelabschnitt in Richtung Nordwesten.
Way ahead
Trotz eindrucksvoller Erfolge auf strategischer Ebene, wie der Operation „Spiderweb“, ist die Situation an der Front für die Ukraine zermürbend. Sie steht noch immer vor der Herausforderung, ausreichend Gerät für ihre Verteidigung zu erhalten. Alleine in der Kursker Offensive hat sie signifikante Mengen an Material verloren, vor allem westliches Gerät wie Kampfpanzer „Leopard“ 2 oder CV90 Kampfschützenpanzer.
Es gibt aber auch positive Nachrichten für die Ukraine: Sie soll in den nächsten Wochen den „Link 16“ erhalten, ein militärisches WiFi, womit unterschiedliche Waffensysteme in einem Kommunikationsstrang zusammengefasst werden können. Beispielsweise können damit Frühwarnsysteme, wie jenes, das Schweden geliefert hat, mit Fliegerabwehrbatterien der Typen „Patriot“ oder IRIS-T mit F16-Kampfflugzeugen in einem gemeinsamen Netz eingebunden werden. Das verbessert nicht nur die Kommunikation, sondern minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Verlusten von einzelnen Assets wie Kampflugzeugen kommt.
Interessant ist die Diskussion zu weitreichenden Marschflugkörpern, wie die Lieferung von „Taurus“-Systemen. Dabei soll Deutschland solche Marschflugkörper an die Ukraine liefern, damit diese Angriffe bis tief nach Russland hinein durchführen kann. Dieses Vorhaben ist stark umstritten, da Putin wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Ukraine alleine nicht in der Lage wäre, solche Systeme zu betreiben.
Somit würde das für ihn eine Kriegsbeteiligung von NATO-Staaten bedeuten. Der deutsche Bundeskanzler Merz hat vor Kurzem gesagt, dass es zwar keine Reichweitenbeschränkungen gäbe, aber nach wie vor auch keine Lieferung von „Taurus“ an die Ukraine. Man möchte die Ukraine nun beim Bau weitreichender Drohnen vom Typ AN-196 unterstützen.
In den europäischen Staaten gibt es unterschiedliche Auffassungen über die aktuelle Situation und den weiteren Verlauf des Krieges. Einige Experten sind der Meinung, dass Putin diesen Krieg nicht mehr gewinnen könne, andere meinen jedoch, dass Russland durchaus die Kapazität habe, diesen noch mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, weiterzuführen.
In diesem Zusammenhang empfiehlt sich ein Blick auf die bisherigen Verluste beider Seiten. Die Internetplattform Oryx hat diese wie folgt beziffert (Stand Juli 2025): Die Ukraine hat bisher über 9 300 Kampffahrzeuge inklusive Ausrüstung und Gerät verloren, während auf der russischen Seite bisher ein Verlust von knapp 22 300 gleichwertiger Systeme zu verzeichnen ist. Das entspricht einem Verhältnis von 1:2,4, wobei das Verhältnis bei den Kampffahrzeugen sogar 1:2,8 beträgt. Das ist innerhalb der militärischen Norm von 1:3, bei der man von einer mindestens dreifachen Überlegenheit (Material und Personal) des Angreifers gegenüber dem Verteidiger ausgeht, damit eine erfolgreiche Angriffsführung möglich ist.
Friedensverhandlungen
Die Darstellung der Situation bzw. deren Entwicklung zeigt, dass sich das ukrainische Dilemma fortsetzt, weshalb Ende Mai der Blick nach Istanbul auf die dortigen Friedensverhandlungen gerichtet war. Die USA haben für die Ukraine offensichtlich festgelegt, dass sie gewisse Rahmenbedingungen akzeptieren muss. Das heißt, dass sie eigenes Territorium zumindest temporär an Russland zu übergeben hat. Zusätzlich schließen die USA eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus.
Russland hat eine klare Meinung zu den Friedensverhandlungen. Es möchte seine Maximalforderungen umgesetzt wissen, und es scheint, dass es diese Ambition mit seinen industriellen Anstrengungen vor allem bei der Waffenproduktion mit Taten unterstreicht. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass Russland diesen Krieg nicht alleine führt. Nordkorea ist mittlerweile Kriegspartei und liefert große Mengen an Munition. Der Iran liefert große Mengen an Drohnen und China unterstützt immer dort, wo es gerade notwendig ist.
Die derzeitige Situation ist somit ambivalent, vor allem hinsichtlich der Frage, wie sich das Verhältnis der USA zu Russland tatsächlich darstellt. So gibt es auf dem Social-Media-Kanal „X“ eine hitzige Debatte zwischen den beiden Staaten. Dabei meinte Trump, dass Putin wegen der Angriffe auf Kiew, Anfang Juni, völlig verrückt geworden sei und mit dem Feuer spiele.
Medwedew drohte wiederum damit, dass ein Dritter Weltkrieg im Raum stehen würde. Während sich die USA und Russland streiten, sind die Gesellschaften Europas mit Desinformationskampagnen konfrontiert, die als Teil der hybriden Kriegsführung um sich greifen. Diesen wird nur halbherzig mit Maßnahmen in Form von Sanktionen begegnet, die wiederum häufig umgangen werden.
Mittlerweile geht auch Deutschland davon aus, dass Russland diesen Krieg nicht komplett verlieren wird, und ein Friede nur mit einem Kompromiss zu erzielen sein wird. Denkbar wäre eine Situation, ähnlich der des Winterkrieges 1939/40. Damals hat Finnland zwar signifikante Gebiete verloren, konnte aber als souveräner Staat bestehen bleiben.
Welches Ergebnis die in diesem Beitrag skizzierten Entwicklungen auf den Verlauf des Ukraine-Krieges bzw. für einen möglichen Frieden haben werden, wird sich im Lauf der nächsten Monate zeigen. Viel wird vom Verhalten und Verhandlungsgeschick von US-Präsident Donald Trump abhängen.Jedenfalls bleiben die Lage und die Auswirkungen des Krieges auf die globale Sicherheitspolitik so dynamisch, wie er sich aktuell an der Front statisch präsentiert.
Oberst dG Mag.(FH) Dr. Markus Reisner, PhD;
Leiter Institut 1 an der Theresianischen Militärakademie

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).