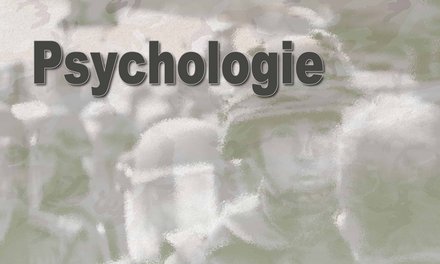Ehrenzeichen für Soldaten

Die Republik Österreich kennt verschiedene sichtbare Auszeichnungen für besondere Verdienste. Sie werden durch den Bundespräsidenten und durch die ressortzuständigen Minister verliehen. Für die Soldaten des Bundesheeres haben Ehrenzeichen besondere Bedeutung, weil sie die damit verbundenen Werte wie Dienstreue, Loyalität und Pflichtgefühl leben. Daraus entstand eine gewachsene militärische Tradition.
Bund
Der Bundespräsident verleiht das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich in seinen 14 verschiedenen Stufen (Ehrenzeichen, Verdienstzeichen und Medaillen für Verdienste um die Republik Österreich), das Ehrenzeichen und die beiden Ehrenkreuze für Wissenschaft und Forschung sowie das Militär-Verdienstzeichen.
Ministerien
Protokollarisch, also rangmäßig darunter, befinden sich die von den Bundesministern verliehenen Auszeichnungen. Das sind sichtbare Ehrungen, die für den Wirkungsbereich der Ministerien verliehen werden können. Neben dem einheitlichen Bundesehrenzeichen, das von jedem Minister für ehrenamtliche Tätigkeiten in seinem Verantwortungsbereich verliehen werden kann, haben die Bundesministerien für Landesverteidigung (BMLV) und für Inneres (BMI) eigene Auszeichnungen. Ergänzend verleiht das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ebenfalls eine ministerielle Auszeichnung – das einstufige Grubenwehrehrenzeichen. Auf Bundesebene gibt es keine Orden. Es werden nur Ehrenzeichen, Verdienstzeichen, Ehrenkreuze und Medaillen verliehen. Diese rechtliche Vorgabe wirkt sich nur auf die Bezeichnung der Ehrung aus, nicht auf das Aussehen.
Bundesländer
Alle neun Bundesländer verleihen eigene Landesauszeichnungen für Verdienste in ihrem Wirkungsbereich. Diese Landesauszeichnungen sind nach den Bundesauszeichnungen zu reihen. Neben den erwähnten Bezeichnungen von Auszeichnungen haben nur die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Kärnten zusätzlich die klassische Bezeichnung Orden in Verwendung. Kärnten hat als einziges Bundesland anlassbezogen eine militärische Landesauszeichnung gestiftet, das Verdienstzeichen des Landes Kärnten für den Grenzsicherungseinsatz 1991.
Die Distanz und schließlich die rechtliche Ablehnung der Bezeichnung Orden auf Bundesebene ist historisch erklärbar. Die Republik grenzte sich 1919 mit dem Gesetz über die Aufhebung des Adels und der bis dahin verliehenen Orden von der Monarchie ab. Bei der notwendigen Stiftung neuer republikanischer Auszeichnungen im Jahr 1922 wurden die noch heute gültigen Bezeichnungen gewählt.
Sichtbar zu tragende Auszeichnungen für Tapferkeit, Verdienste, Einsätze und Dienstzeiten sind ein international üblicher und fester Bestandteil der militärischen Belohnungs- und Erinnerungskultur. Das Bundesheer hat mit der ursprünglichen Stiftung der Wehrdiensterinnerungsmedaille und des Bundesheerdienstzeichens zweifach ein symbolisches Denkmal gesetzt. Erstens durch die neuartige Stiftung einer Auszeichnung als Belohnung für den Staatsbürger, der seiner Wehrpflicht im demokratischen Heer nachkommt, und zweitens durch das Aufgreifen der alten österreichischen Tradition eines Dienstzeichens für langjährige Dienstleistung. Die Auszeichnungen des BMLV knüpfen klar erkennbar an eine kontinuierliche Tradition an, die sich von der österreichisch-ungarischen Monarchie bis zur Ersten Republik Österreichs erstreckt.
Leopoldskreuz
Das Leopoldskreuz ist ein österreichischer Kreuztyp. Im Jahr 1808 schuf Kaiser Franz I. den Leopolds-Orden. Dieser war ein Verdienstorden, der für zivile und militärische Verdienste bis 1918 in drei Klassen verliehen wurde. Der Orden wurde zu Ehren seines Vaters, Kaiser Leopold II., benannt. Das für diesen Orden neu gestaltete Ordenskreuz ist ein Tatzenkreuz mit nach außen gebogenen Armen und nach innen geschwungenen Kreuzenden. Dieser Kreuztyp fand erstmalig bei der Gestaltung des Leopolds-Ordens Verwendung. Deshalb wird er seit damals auch als Leopoldskreuz, Leopoldkreuz oder als Tatzenkreuz leopoldinischen Typs bezeichnet.
In späteren Jahren wurde dieser für Österreich typische Kreuztyp immer wieder verwendet. Kaiser Franz Joseph I. stiftete 1849 das Militärverdienstkreuz und das Militärdienstzeichen. Beide Kreuze wurden als Leopoldskreuz gestaltet und ebenfalls bis 1918 verliehen. In der Zwischenkriegszeit stiftete der Bundesstaat Österreich das Militärdienstzeichen 1934 neu. Dabei wurde ebenfalls derselbe Kreuztyp wie in der Monarchie verwendet – das Leopoldskreuz. Ab den 1880er-Jahren gaben verschiedene österreichische Krieger- und Veteranenvereine Kreuze für langjährige Mitgliedschaft aus. Diese Kreuze waren den Militärdienstzeichen ähnlich und immer als Leopoldskreuz ausgeführt. Lediglich das Mittelschild im Zentrum war anders. Zwischen den Kreuzarmen war häufig ein Lorbeerkranz eingefügt.
Das seit 1808 in Verwendung stehende österreichische Leopoldskreuz ist anders gestaltet als das 1813 vom König von Preußen (Friedrich Wilhelm III.) gestiftete Eiserne Kreuz. Diese beiden unterschiedlichen Kreuztypen stehen für unterschiedliche Traditionen. Das Bundesheer der Zweiten Republik führte 1963 das Bundesheerdienstzeichen ein. Es wird bis heute in unveränderter Form verliehen – lediglich die Bezeichnung wurde 1989 auf Wehrdienstzeichen geändert. Die Republik Österreich hat das Militär-Verdienstzeichen im Jahr 1989 als höchste militärische Auszeichnung gestiftet. Es ähnelt dem Militärverdienstkreuz der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Bundesstaates Österreich. Die Form des Kreuzes ist das Leopoldskreuz.
Auszeichnung Bundespräsident
Militär-Verdienstzeichen
Das Militär-Verdienstzeichen (MVZ) wurde mit dem Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen (MAG) vom 28. Juni 1989, BGBl. Nr. 361/1989, ausgegeben und am 27. Juli 1989 gestiftet. Durch Ergänzungen (Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung, BGBl. Nr. 551/1989, vom 13. November 1989; dieses aufgehoben durch BGBl. II Nr. 299/2001; BGBl. Nr. 327/1990, vom 7. Juni 1990) wurde die Gestaltung der Auszeichnung verfügt und die ursprünglichen Voraussetzungen zur Verleihung erweitert. Demnach kann das Militär-Verdienstzeichen an Personen verliehen werden, die sich durch herausragende Leistungen auf militärischem oder zivilem Gebiet um die militärische Landesverteidigung besonders verdient gemacht haben. Aufgrund der Erweiterung der Voraussetzungen gelten als Verdienste insbesondere auch hervorragende Leistungen anlässlich der Kärntner Freiheitskämpfe 1918/1919, sofern hierfür Anspruch auf eine finanzielle Zulage nach dem Kärntner Kreuz-Zulagengesetz 1970, BGBl. Nr. 194/1970, besteht.
Das Militär-Verdienstzeichen verleiht der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung. Den Antrag auf Erstattung eines solchen Vorschlages stellt der Bundesminister für Landesverteidigung. Das Militär-Verdienstzeichen wird in einem Etui samt Urkunde überreicht und als Steckdekoration an der linken Brustseite getragen. Kaiser Franz Joseph I. stiftete 1849 das Militärverdienstkreuz. Dieses wurde nur an Offiziere für militärische Verdienste im Krieg wie im Frieden verliehen. Ursprünglich war es eine einstufige Brustdekoration am Dreiecksband. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden noch zwei weitere höherrangige Stufen eingeführt. Eine Halsdekoration als 2. Klasse und eine Steckdekoration als 1. Klasse. Die bisherige Brustdekoration wurde zur 3. Klasse. Der Bundesstaat Österreich schuf im Jahr 1935 das dreiklassige Militärverdienstkreuz in leicht geänderter Form.
Das Militär-Verdienstzeichen der Republik Österreich ähnelt der 1. Klasse der beiden früheren historischen Stiftungen. Die ersten Verleihungen des MVZ erfolgten 1990 an 174 noch lebende Kärntner Abwehrkämpfer. Ursprünglich wurde die Auszeichnung 191 Personen zuerkannt, davon 14 Frauen. Bis zur Überreichung waren aber bereits 17 Empfänger verstorben. Seit 1990 bis einschließlich 31. Dezember 2024 erfolgten weitere 28 Verleihungen an österreichische Staatsbürger, sodass die Gesamtzahl 202 Verleihungen beträgt.
Auszeichnungen BMLV
Das BMLV verleiht insgesamt 16 Auszeichnungen für Tapferkeit, Verdienst, Verwundung und Wehrdienstleistungen. Deren Rangfolge ist genau festgelegt und beim Tragen der Dekorationen zu beachten. Da die Verleihung einer höheren Stufe die vorherige Verleihung der niederen voraussetzt, darf bei der Wehrdienstmedaille und dem Wehrdienstzeichen jeweils nur die höchste Stufe getragen werden. Das unerlaubte Tragen einer Auszeichnung ist nicht nur unstatthaft, sondern kann strafrechtlich verfolgt werden. Die Verleihung einer ministeriellen Auszeichnung löst keine Interkalarfrist (die Bezeichnung jener, in der Regel fünfjährigen, Mindestfrist nach der Verleihung von Auszeichnungen wie Ehrenzeichen oder Berufstitel, vor deren Ablauf die Verleihung der nächsthöheren Auszeichnung nicht erfolgen soll; Anm.) zu einer Bundesauszeichnung durch den Bundespräsidenten aus.
Die Reihung in der folgenden Vorstellung der Auszeichnungen folgt nach den Jahren der Stiftung. Dadurch lässt sich die Entwicklung des Systems der Auszeichnungen des BMLV an den Bedürfnissen und Einsätzen des Bundesheeres ablesen. Die ursprünglichen Fassungen von Bundesgesetzen und Verlautbarungen zu Auszeichnungen sind sprachlich klar und nachvollziehbar formuliert. Mit fortschreitenden Ergänzungen und Änderungen nimmt die Verständlichkeit jedoch häufig ab – sowohl hinsichtlich der Sprache als auch des Inhaltes.
Wehrdiensterinnerungsmedaille und Bundesheerdienstzeichen
Die beiden bekanntesten militärischen Auszeichnungen des Bundesheeres der Zweiten Republik sind zugleich auch die ersten, die verliehen wurden. Geschaffen wurden sie separat mit zwei eigenen Bundesgesetzen, die gemeinsam verlautbart wurden:
- Bundesgesetz über die Wehrdiensterinnerungsmedaille vom 10. Juli 1963, BGBl. 203/1963, ausgegeben am 30. Juli 1963;
- Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzeichen vom 10. Juli 1963, BGBl. 202/1963, ausgegeben am 30. Juli 1963.
Die Wehrdiensterinnerungsmedaille wurde für alle Soldaten gestiftet, die im Bundesheer der Zweiten Republik den Grundwehrdienst absolviert haben. Eine Verleihung an Soldaten, die ihre militärische Laufbahn in der B-Gendarmerie, dem Vorläufer des Bundesheeres, oder im Bundesheer der Ersten Republik oder davor in Österreich begonnen hatten, war nicht möglich. Diese Auszeichnung war damals neu und sollte den geleisteten Grundwehrdienst anerkennen. Mittlerweile ist sie ein allgemein bekanntes und sichtbares Symbol des Dankes des Staates bzw. des Bundesheeres an alle österreichischen Soldaten.
Im Unterschied dazu knüpft die Stiftung des Bundesheerdienstzeichens an eine alte österreichische Tradition an. Bereits 1849 wurde das Militärdienstzeichen gestiftet. Es wurde bis 1938 in zwei unterschiedlichen Kategorien für Offiziere und Mannschaften nach einer langen Dienstzeit verliehen. Im ersten Bundesheer gelangte diese Dienstauszeichnung erst im Jahr 1934 wieder zur Verleihung. Bemerkenswerterweise ist die Grundform des Kreuzes, das seit 1849 unveränderte Leopoldskreuz, die eigenständige österreichische Kreuzform. Die bewusste Anknüpfung an eine alte österreichische Tradition in Form des Kreuzes, aber auch an die sichtbare Belohnung für langjährige militärische Dienstzeiten, ist damit klar erkennbar. Eine Übersicht zu den Verleihungszahlen ist erst ab der Umsetzung des Bundesgesetzes über militärische Auszeichnungen (MAG) 1989 und der in Folge begonnenen elektronischen Speicherung möglich. Über die von 1963 bis 1989 verliehenen Auszeichnungen sind aufgrund mangelnder elektronischer Daten keine verlässlichen Angaben möglich.
Wehrdienstmedaille
Die Wehrdiensterinnerungsmedaille (WDEM) wurde ursprünglich nur in einer Stufe gestiftet. Sie war für jene Soldaten vorgesehen, die den damaligen Grundwehrdienst in der Dauer von neun Monaten (mit der Waffe) oder von zwölf Monaten (ohne Waffe) absolviert und sich dabei „wohl verhalten“ haben. Eine rückwirkende Verleihung an Personen, die vor dem Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt hatten, war ebenfalls vorgesehen. Die ersten Verleihungen fanden 1964 statt.
Mit dem Bundesgesetz zur Abänderung der Wehrdiensterinnerungsmedaille vom 13. Februar 1969, BGBl. Nr. 98/1969, ausgegeben am 27. März 1969, wurde die Wehrdiensterinnerungsmedaille in Silber (WDEMS) neu gestiftet und dadurch die bisherige einstufige Auszeichnung zur Wehrdiensterinnerungsmedaille in Bronze (WDEMB) umgestaltet. Die WDEMS wurde an wehrpflichtige Reservisten verliehen, die an Inspektionen oder Instruktionen – die damals gesetzlich verpflichtenden Waffenübungen – im Gesamtausmaß von zwölf Tagen teilgenommen hatten, wenn seit der Entlassung aus dem ordentlichen Präsenzdienst fünf Jahre verstrichen waren. Die Wehrgesetznovelle 1971 änderte diese Voraussetzungen und die WDEMS wurde schließlich für insgesamt 60 Tage Truppen- oder Kaderübung (TÜ oder KÜ) zuerkannt. Es gab nur wenige wehrpflichtige Reservisten, die diese Anzahl an verpflichteten Übungstagen erfüllten, weshalb diese Medaille nur selten verliehen wurde. Eine neuerliche Änderung erfolgte durch das Bundesgesetz vom 28. Juni 1989 über militärische Auszeichnungen (MAG), BGBl. 361/1989, ausgegeben am 27. Juli 1989. Die bisherige zweistufige Auszeichnung wurde um eine dritte erweitert, die Bezeichnungen in die bis heute gültigen geändert und die Verleihungsbestimmungen entsprechend angepasst.
Seit 1998 haben Frauen die Möglichkeit, einen freiwilligen Ausbildungsdienst in der Dauer von sechs Monaten zu leisten. Damit verbunden ist auch die Möglichkeit zur anschließenden Ableistung von Wehrdienstleistungen in der Miliz. An weibliche Soldaten erfolgt die Verleihung für den geleisteten Ausbildungsdienst und spätere Kader- oder Milizübungen in derselben Zeitspanne. Für die Wehrdienstmedaille gelten die folgenden Verleihungsbestimmungen:
- Die Wehrdienstmedaille in Bronze (WDMB) ist an Personen zu verleihen, die den Grundwehrdienst oder Ausbildungsdienst in der Dauer von sechs Monaten geleistet haben;
- Die Wehrdienstmedaille in Silber (WDMS) ist an Personen zu verleihen, die nach dem Grundwehrdienst oder Ausbildungsdienst von sechs Monaten Truppen-, Kader- oder Milizübungen im Gesamtausmaß von 30 Tagen geleistet haben, bzw. an Personen, die nach dem Grundwehrdienst von acht Monaten eine Truppen-, Kader- oder Milizübung von mindestens einem Tag geleistet haben;
- Die Wehrdienstmedaille in Gold (WDMG) ist an Personen zu verleihen, die nach dem Grundwehrdienst oder Ausbildungsdienst von sechs Monaten Truppen-, Kader- oder Milizübungen im Gesamtausmaß von 60 Tagen geleistet haben bzw. an Personen, die nach dem Grundwehrdienst von acht Monaten Truppen-, Kader- oder Milizübungen im Gesamtausmaß von 30 Tagen geleistet haben.
Seit 2008 werden Milizübungen (MÜ) einheitlich durchgeführt. Die bisherige Bezeichnung und Unterscheidung von Truppen- und Kaderübungen (TÜ und KÜ) wurde gestrichen. Zwar wurden die Medaillen umbenannt, ihr Aussehen blieb jedoch unverändert. Alle Stufen werden ohne Etui samt Urkunde überreicht. Ursprünglich wurde die WDEM in einer durchsichtigen weißen Papiertüte mit aufgedruckter Bezeichnung der Auszeichnung verliehen. Diese Tüten kamen nur in den Anfangsjahren zum Einsatz, sind heute kaum mehr erhalten und daher sehr selten. Genaue Verleihungszahlen zur Wehrdienstmedaille in allen drei Stufen können erst ab der Umsetzung des Bundesgesetzes über militärische Auszeichnungen (MAG) 1989 und der in Folge begonnenen elektronischen Speicherung gegeben werden. Über die von 1963 bis 1989 verliehenen Wehrdiensterinnerungsmedaillen in Bronze und Silber sind aufgrund mangelnder elektronischer Daten keine Angaben möglich.
Von 1989 bis zum 31. Dezember 2024 wurden verliehen:
| Wehrdienstmedaille in Bronze (WDMB) | 580 247 (davon 1 424 an Frauen) |
| Wehrdienstmedaille in Silber (WDMS) | 62 441 (davon 27 an Frauen) |
| Wehrdienstmedaille in Gold (WDMG) | 28 079 (davon 13 an Frauen) |
| Wehrdienstzeichen 3. Klasse (WDZ3) | 55 958 (davon 599 an Frauen) |
| Wehrdienstzeichen 2. Klasse (WDZ2) | 32 477 (davon 139 an Frauen) |
| Wehrdienstzeichen 1. Klasse (WDZ1) | 23 314 (davon 20 an Frauen) |
Wehrdienstzeichen
Das Bundesheerdienstzeichen (BHDZ) wurde im Jahr 1963 in den bis heute unveränderten drei Stufen gleichzeitig mit der Wehrdiensterinnerungsmedaille gestiftet:
- Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse (BHDZ3) für eine fünfjährige Dienstzeit;
- Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse (BHDZ2) für eine 15-jährige Dienstzeit;
- Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse (BHDZ1) für eine 25-jährige Dienstzeit im Bundesheer der Zweiten Republik Österreich.
Gleichzeitig mit den gesetzlichen Änderungen der Wehrdiensterinnerungsmedaille folgte das Bundesgesetz zur Abänderung des Bundesheerdienstzeichens vom 13. Februar 1969, BGBl. Nr. 97/1969, ausgegeben am 27. März 1969. Die Verleihungsvoraussetzungen wurden dahingehend geändert, dass auch Dienstzeiten im Bundesheer vor dem 13. März 1938 Erwähnung finden. Die Verleihung an Wehrpflichtige des Reservestandes wurde ebenfalls erstmals ermöglicht. Gleichzeitig mit diesem Gesetz wurde die Spange zum Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse (BHDZ3mSp) eingeführt. Diese wurde all jenen zuerkannt, die bereits Träger des Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse waren und Dienstzeiten im Bundesheer vor dem 13. März 1938 nachweisen konnten.
Die Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung vom 9. Mai 1969 über die Ausstattung und die Art des Tragens des Bundesheerdienstzeichens, BGBl. 164/1969, ausgegeben am 4. Juni 1969, regelt nur das Aussehen der schon bisher in Verwendung stehenden Dekorationen und der neu eingeführten Spange. Eine interessante Auffälligkeit erscheint bei der Durchsicht der Personalakten von Offizieren des Bundesheeres. Demnach wurde bei der Verleihung der im Jahr 1969 neu eingeführten Spange zum Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse nicht nur eine Dienstzeit vor dem 13. März 1938 berücksichtigt. Auch jene in der B-Gendarmerie – dem direkten Vorläufer des Bundesheeres der Zweiten Republik in den Jahren 1953 bis 1955 – wurde damit anerkannt. Eine bestimmte Dauer der Dienstzeit war für die Verleihung der Spange nicht gefordert.
Bei Verleihungen der Bundesheerdienstzeichen 1. und 2. Klasse wurde die Dienstzeit in der B-Gendarmerie eingerechnet. Dienstzeiten vor dem 13. März 1938 wurden eindeutig nicht berücksichtigt. In den zuvor genannten Gesetzestexten findet sich zu diesen beiden Vorgehensweisen der Verleihung kein Hinweis. Vermutlich wurde dies durch einen internen Erlass geregelt, der nicht veröffentlicht wurde. Eine neuerliche Änderung erfolgte durch das Bundesgesetz vom 28. Juni 1989 über militärische Auszeichnungen (MAG), BGBl. 361/1989, ausgegeben am 27. Juli 1989. Wiederum gleichzeitig mit der Namensänderung der Wehrdienstmedaille erfolgte die noch heute gültige Änderung der Bezeichnung in
- Wehrdienstzeichen 3. Klasse (WDZ3),
- Wehrdienstzeichen 2. Klasse (WDZ2) und
- Wehrdienstzeichen 1. Klasse (WDZ1).
Die früheren Bundesheerdienstzeichen und die heutigen Wehrdienstzeichen können auch an Milizsoldaten verliehen werden, die bei einer freiwilligen Waffenübung (fWÜ) eine bestimmte Anzahl von Tagen geleistet haben:
- Wehrdienstzeichen 3. Klasse frühestens nach fünf Jahren ab Entlassung aus dem 6-monatigen Grundwehrdienst und einer Wehrdienstleistung von mindestens 60 Tagen fWÜ;
- Wehrdienstzeichen 2. Klasse (WDZ2) frühestens nach 15 Jahren ab Entlassung aus dem 6-monatigen Grundwehrdienst und einer Wehrdienstleistung von mindestens 180 Tagen fWÜ;
- Wehrdienstzeichen 1. Klasse (WDZ1) frühestens nach 25 Jahren ab Entlassung aus dem sechsmonatigen Grundwehrdienst und einer Wehrdienstleistung von mindestens 300 Tagen fWÜ.
Dabei ist klar zu erkennen, dass zwölf Tage fWÜ umgerechnet für eine aktive Dienstzeit von einem Jahr stehen. Die Leistung von Truppen-, Kader- und Milizübungen kommt für eine Würdigung durch das Wehrdienstzeichen nur insofern in Betracht, als solche Präsenzdienstleistungen über das für die Verleihung der Wehrdienstmedaille in Gold erforderliche Gesamtausmaß hinausgehen. Seit ihrer Stiftung wurden die Bundesheer- und Wehrdienstzeichen zwar mehrfach umbenannt, ihr äußeres Erscheinungsbild blieb dabei jedoch unverändert. Alle drei Dekorationen werden immer in einem Etui und mit einer Urkunde überreicht. Üblicherweise wird das WDZ3 in einem weißen, das WDZ2 in einem blauen und das WDZ1 in einem roten Etui verliehen. In der Praxis kam es jedoch zu Abweichungen: Insbesondere in den 1970er-Jahren wurden durchsichtige Plastiketuis angeschafft und fanden vereinzelt auch in späteren Jahren noch Verwendung.
Exakte Verleihungszahlen zum Wehrdienstzeichen in allen drei Klassen können erst ab der Umsetzung des Bundesgesetzes über militärische Auszeichnungen (MAG) 1989 und der in Folge begonnenen elektronischen Speicherung gegeben werden. Über die von 1963 bis 1989 verliehenen Bundesheerdienstzeichen aller drei Klassen sowie der Spange zum Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse sind aufgrund mangelnder elektronischer Daten keine Angaben möglich.
Fazit
Die Wehrdienstzeichen haben sich seit ihrer Einführung in der Zweiten Republik sowohl in ihrer Bezeichnung als auch in den Verleihungsmodalitäten mehrfach verändert. Trotz dieser Entwicklungen blieb ihr äußeres Erscheinungsbild weitgehend konstant. Die gesetzlichen Grundlagen und die damit verbundenen organisatorischen Regelungen spiegeln nicht nur den Wandel militärischer Strukturen wider, sondern auch den Versuch, Leistungen im Rahmen des Wehrdienstes über Jahrzehnte hinweg vergleichbar zu erfassen und formell anzuerkennen. Der vorliegende Überblick dokumentiert diese Entwicklungslinien und stellt die derzeit gültige Systematik der Wehrdienstzeichen dar.
Oberrat Oberst dhmfD Prof. Mag. Peter Steiner;
Referent Sammlung Uniformen, Orden, Ausrüstung & Insignien im Heeresgeschichtlichen Museum

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).