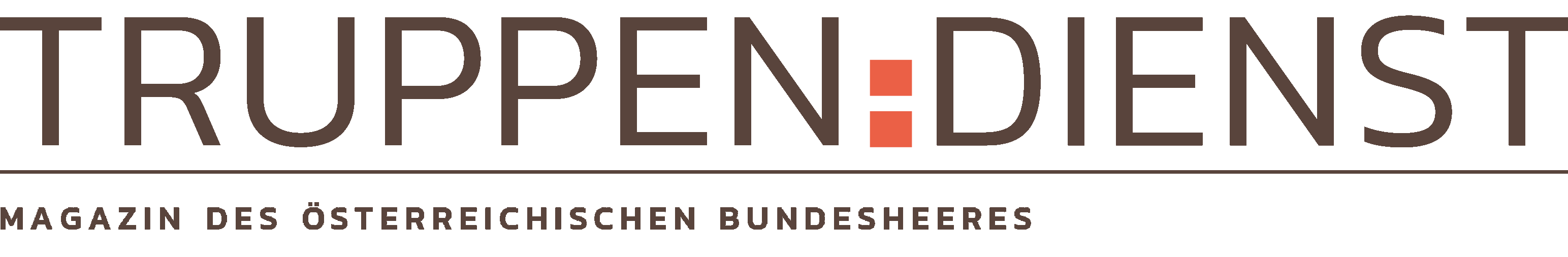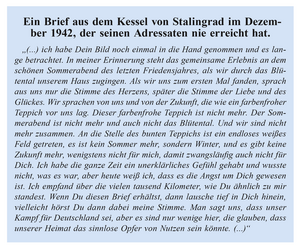Stalingrad - 75 Jahre danach

Im Februar 2018 war es 75 Jahre her, dass die 6. Armee in der Schlacht um Stalingrad, dem heutigen Wolgograd, untergegangen ist. Damit wurde die Wende des Krieges der Deutschen Wehrmacht im Feldzug gegen die Sowjetunion eingeleitet und auch das Schicksal vieler Österreicher besiegelt. Viele von ihnen konnten erst in der jüngsten Vergangenheit beigesetzt werden.
In den Herbsttagen des Jahres 1942 standen auf deutscher Seite innerhalb der 6. Armee 94 Divisionen im Kampf. Vier davon waren zu 90 Prozent österreichisch, mit etwa 40.000 bis 45.000 Soldaten, wie die 100. Leichte Jägerdivision aus dem oberösterreichischen Salzkammergut, die 297. Infanteriedivision (Baden), die 9. FlAK-(Fliegerabwehrkanonen-)Division (Wien-Kagran) und die 44. Infanteriedivision „Hoch- und Deutschmeister“ aus Wien und Niederösterreich. Mit über einer Million gefallenen russischen und über 300.000 gefallenen deutschen Soldaten zusammen mit ihren Verbündeten (Achsenmächten) hat die Schlacht um Stalingrad den höchsten Blutzoll in einem Krieg gefordert - vergleichbar mit den Opferzahlen von Verdun, Dresden, Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen.
Von den 107.800 von den Sowjets gefangen genommenen Angehörigen der Wehrmacht waren 84.000 ein Jahr später bereits tot. Nur knapp über 6.000 kehrten in die Heimat zurück. Den siegreichen Sowjetsoldaten wurde nach dem Krieg ein monumentales Denkmal am Mamajew-Hügel in der Stadt selbst errichtet, für die Deutschen - mit ihnen die Österreicher - und Rumänen, Italiener, Ungarn und Kroaten sollten noch Jahrzehnte vergehen, bis man sich offiziell an deren (unfreiwilligen) Einsatz erinnern durfte.
Exkursion ins Sperrgebiet
Es brauchte einen politischen Umbruch im Sowjetsystem, der mit Regierungschef Michail Gorbatschow in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eingeleitet wurde. Das Wort „Glasnost“, und damit verbunden die Öffnung der russischen Archive, war der Schlüssel auch für die Aufarbeitung der Geschichte rund um die Erinnerung an die Schlacht um Stalingrad und an die dort gefallenen Soldaten der ehemaligen Achsenmächte.
Im Mai 1992 besuchte eine Delegation des Österreichischen Schwarzen Kreuzes (ÖSK) im Anschluss an die „Internationale Konferenz über Kriegsgefangenschaft in Russland“ die Stadt Stalingrad, das heutige Wolgograd. Hierbei bot man erstmals eine Exkursion auf die bis 1990 als Sperrgebiet deklarierten Schlachtfelder aus den Jahren 1942/43 an. In dieser Steppenlandschaft, einer baum- und schattenlosen Ebene, liegen heute vereinzelte Kolchosen mit niedrigen Lehmhütten.
Die Teilnehmer des ÖSK machten dort eine erschütternde Entdeckung: Unbestattet lagen noch immer Gefallene auf dem ehemaligen Schlachtfeld. Tausende Gebeine, Totenschädel in Stahlhelmen und Erkennungsmarken, deren Träger nie identifiziert werden konnten, zeugten von den erbitterten Kämpfen. Die Toten wurden seinerzeit anscheinend nicht oder nur oberflächlich beerdigt. Noch durch die Wehrmacht angelegte Soldatenfriedhöfe waren von den Sowjets bereits während und nach dem Krieg dem Erdboden gleichgemacht worden.
Heute noch hat dieses Landschaftsbild nichts von der Eintönigkeit und Leere des damaligen Schlachtfeldes verloren. Weit und breit keine größere Ortschaft, nur brachliegendes Land mit Relikten aus dem Krieg. Unentwegt streift der Wind über die flache, bis hin zum weiten Horizont wahrzunehmende Steppe, deren Boden aus einer salzhaltigen Lehmschicht besteht, die ab und zu mit Wermutstauden bedeckt ist, und lässt erahnen, was die Soldaten damals - tausende Kilometer entfernt von ihrer Heimat - erlitten haben mussten: Angst vor dem Unbekannten und den Wunsch, zu überleben, als tiefsitzende Gedanken, die sich in dieser Einöde widerspiegeln.
Denkmal in Pestschanka
Nachdem die Delegation nach Österreich heimgekehrt war, informierte der Landesgeschäftsführer des ÖSK, Ing. Otto Jaus, den ORF-Redakteur und ÖSK-Kuratoriumsmitglied Professor Walter Seledec von dieser grausamen Entdeckung, worauf der ORF ein Redaktionsteam zur Dokumentation entsandte und einen Bericht im österreichischen Fernsehen zur Ausstrahlung brachte.
Noch im selben Jahr etablierte sich zur Erinnerung an die in der Deutschen Wehrmacht in Stalingrad gefallenen Österreicher ein Personenkomitee, ausgehend vom Österreichischen Schwarzen Kreuz rund um ORF-Redakteur Walter Seledec. Es wies hohe und höchste Vertreter aus Politik, Geistlichkeit, Wirtschaft und Militär - unter dem Vorsitz von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Helmut Zilk - in seinen Reihen auf und umfasste Personen aus ganz Österreich. Ziel war es, vorerst mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. einen Friedhof anzulegen und dort die Überreste der Gefallenen beizusetzen.
Durch Österreich sollte dabei ein Mahnmal errichtet werden, das an diese blutige Tragödie erinnern und zukünftigen Generationen klarmachen sollte, was Krieg in letzter Konsequenz immer bedeutet - nämlich den Tod! Bestand vorweg der Plan, in der Stadt Wolgograd am „Platz der Versöhnung“ dieses Denkmal zu errichten, so musste dieser jedoch bald aufgegeben werden. Zu groß war die Erinnerung und der Schmerz der noch lebenden sowjetischen Kämpfer und der ehemaligen Stalingrader Zivilbevölkerung an die Ereignisse im Herbst/Winter 1942/43.
Die logische, und damit umsetzbare Konsequenz war es daher, sich einen Ort außerhalb der Stadt zu wählen, der einerseits auf die Gefühle der Bevölkerung Rücksicht nahm und andererseits einen historischen Hintergrund zur Schlacht um Stalingrad bildet. Die Wahl fiel auf das Dorf Pestschanka, 20 Kilometer westlich von Stalingrad in der Steppe gelegen, wo die vorwiegend aus Österreichern gebildete 297. Infanteriedivision der Deutschen Wehrmacht in harten Kämpfen aufgerieben wurde.
Nach den Entwürfen der Architekten Prof. Dr. Wilhelm Holzbauer und DI Dieter Pal wurde ein Denkmal zur Erinnerung an die Opfer der Schlacht um Stalingrad errichtet, das am 8. Juni 1996 in einer groß angelegten und berührenden Feier seiner Bestimmung übergeben wurde. Es handelt sich um eine zehn Meter hohe Stahlskulptur, die eine gegen ein Kreuz geneigte Stelle (frei stehende, mit Relief oder Inschrift versehene Platte) in Form einer Speerspitze darstellt. Die Außenverkleidung sollte nach dem Willen der Architekten bewusst rosten, um je nach Sonnenstand ein Farbenspiel zu ergeben, das den Eindruck einer lebenden Oberfläche entstehen lässt.
Bei der Eröffnung des Denkmales betonte Bürgermeister Dr. Helmut Zilk, dass dieses Mahnmal nicht nur als Soldatendenkmal gedacht sei, sondern an alle Opfer der Schlacht um Stalingrad erinnern solle. Der Grazer Historiker und Vizepräsident des ÖSK, Univ.-Prof. Dr. Stefan Karner, führte die moralische Verantwortung der Nachfahren der Opfer, die durch die Öffnung der russischen Archive in ihrer gesamten Tragweite nunmehr erfasst werden konnte, ins Treffen. Zugleich betonte er, dass zur Verständigung über den Gräbern der toten Soldaten aber auch das ehrliche Eingeständnis von Schuld gehöre, die Angehörige von Einsatzgruppen und der Deutschen Wehrmacht, namentlich auch der 6. Armee, gegenüber der Zivilbevölkerung auf sich geladen haben.
Seine akribische wissenschaftliche Arbeit bildete letztlich auch den Ausgangspunkt für den Entschluss, in Stalingrad ein Zeichen der Humanität und der Völkerverständigung, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Schlacht, zu setzen. Im Rahmen dieser Geschichtsaufarbeitung wurde dem ÖSK die Möglichkeit geboten, in die im Panoramamuseum in Wolgograd gelagerten Feldpostbriefe, die den Kessel der Schlacht um Stalingrad nicht mehr verlassen konnten, Einsicht zu nehmen. Etwa 500 Briefe wurden kopiert und in Österreich durch Prof. Dr. Karner und das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung aufgearbeitet. Mit Hilfe dieser ehemaligen Feldpost war es in Folge möglich, viele Vermisstenschicksale zu klären. Der berührende Inhalt dieser Briefe bot auch die real historische Basis zur literarischen Aufarbeitung des Themas „Stalingrad“ in der heutigen Zeit.
Das Denkmal in Pestschanka selbst bildet nunmehr einen Ersatzfriedhof, der für die Opfer das ewige Ruherecht und für die Angehörigen eine Erinnerung symbolisieren soll. Die Inschrift kündigt von Trauer, mit „Herr lass sie ruhen in Frieden“, und enthält eine Bitte und zugleich einen Appell: „Ihr Menschen hier, gebt denen, die Euch Feinde waren, das dauernde Ruherecht des Soldaten, und das in russischer Erde!“


Deutsche Kriegsgräberstätte Rossoschka
Mit dem politischen Umbruch in den 90er Jahren konnte auch die Bundesrepublik Deutschland nunmehr in würdiger Form ihrer Toten in und um Stalingrad gedenken. Das Kriegsgräberfürsorgeabkommen von 1992 zwischen Deutschland und der Russischen Föderation ermöglichte die Einrichtung und Pflege von Kriegsgräberstätten. In der Ortschaft Rossoschka, mitten in der Steppe und unweit von Stalingrad gelegen, wurde ein Platz gefunden, um die sterblichen Überreste tausender in der Schlacht gefallener Wehrmachtssoldaten zusammenzuführen und gemeinsam zu bestatten.
Die Anlage ähnelt einer Scheibe, die mit einer Ringmauer begrenzt wird. Im Mai 1999 wurde der Friedhof eingeweiht und 2006 mit Zubauten ergänzt. Bis heute sind dort fast 50.000 deutsche Soldaten beigesetzt worden, davon waren 24.427 namentlich bekannt. Auf Granittafeln, die an der Mauer wie ein Schriftband angebracht sind, sind die Namen der geborgenen deutschen aus dem Kessel und im Umfeld von Stalingrad Gefallenen für die Nachwelt festgehalten. Neben der kreisförmigen Zubettungsfläche sind 107 große Würfel aufgestellt. Jeder von ihnen trägt rund 900 Namen von vermissten deutschen Soldaten (insgesamt 103.234 Namen). Zudem gibt es noch 17 große Würfel für die nicht mehr zu bergenden Soldaten mit 14.563 Namen.
Rossoschka ist zwar nur einer der großen Sammelfriedhöfe im Osten, hat aber sicherlich einen besonderen Symbolwert. Die sterblichen Überreste aller im Umfeld von Stalingrad gefundenen ehemaligen Wehrmachtssoldaten werden nunmehr auf diesem Friedhof bestattet. Im Jahre 2011 war dies unter anderem der ehemalige Gefreite Andreas Dicker aus dem oberösterreichischen Innviertel, der bis dato als vermisst gegolten hat. Diese, zumeist von der Bevölkerung gemeldeten Funde, finden über die Medien Verbreitung und halten die Erinnerung an die Opfer wach.
Gedenkstätte Mamajew-Hügel
Neben dieser Anlage ist ein Friedhof für die sowjetischen Gefallenen entstanden, der bereits im Sommer 1997 eingeweiht worden war. Auch das heutige Russland (davor die Sowjetunion) gedenkt ihrer im „Großen Vaterländischen Krieg“ in der Schlacht um Stalingrad gefallenen Soldaten. Auf der beherrschenden Höhe 102 im Stadtgebiet von Wolgograd befindet sich der Mamajew Kurgan, die „ruhmreiche Höhe Russlands“ genannt.
Diese Gedenkstätte besteht aus einem Park, in dem Statuen, Reliefs und Plastiken errichtet wurden, die allesamt den grimmigen Hass aber auch die soldatischen Tugenden wie Treue und Kameradschaft versinnbildlichen. Überragt wird alles von der 85 Meter hohen Statue „Die Heimat ruft“ von Jewgenij Wutchetitisch. Das Totengedenken ist in den Saal des „Soldatischen Ruhmes“ verlegt, wo eine Hand eine riesige Fackel - das Symbol für die Ewigkeit - hält. Eine begleitende Multimedia-Schau und dazu gespielt die „Träumerei“ von Robert Schumann sorgen für Betroffenheit unter den Besuchern.
Diese Gedenk- und Mahnstätte wurde erst in den 60er Jahren von der damaligen Sowjetunion errichtet - der Totenkult und die Ehrung von gefallenen Soldaten war davor nicht opportun. Es zählten nur das Überleben und der Sieg! Tote und Verluste wurden verschwiegen und zur Geringfügigkeit verfälscht. Es waren daher auch die Bürger der Stadt, die, wie eingangs erwähnt, sich gegen ein konkurrierendes Denkmal der ehemaligen Feinde im Stadtbild von Stalingrad gewehrt haben. Letztendlich siegten aber Vernunft und der gute Wille zu einem Miteinander in Frieden.
Erinnerung an die Opfer
Für alle diese Anlagen steht sinnbildlich die „Madonna von Stalingrad“, eine vom deutschen Arzt Dr. Kurt Reuber anlässlich der Weihnacht 1942 im Kessel von Stalingrad mit Kohlestift gezeichnete Muttergottes. Die Inschrift auf dem Bild „Licht - Leben - Liebe“ soll auf die Sinnlosigkeit der Kriege und das Leben danach hinweisen und die Menschen an die Vergänglichkeit des Seins erinnern.
So weht nunmehr weiter der Wind der Vergangenheit über diese baum- und schattenlose Ebene mit ihren tiefen Staubwegen und heißen Sandstürmen im Sommer, der die tiefe Einsamkeit der Menschen in den eisigen Stürmen und Schneefeldern im Herbst und im Winter besonders hervortreten lässt. Die Natur hat das ehemalige Schlachtfeld endgültig besiegt - durch die Mahnmäler und Gedenkstätten wird jedoch die Erinnerung an die Opfer wach gehalten.
Anmerkung: Der Artikel erschien im TD-Heft 6/2012.
Oberst i.R. Alexander Barthou ist Generalsekretär des Österreichischen Schwarzen Kreuzes -Kriegsgräberfürsorge.