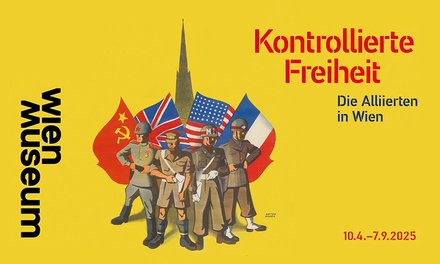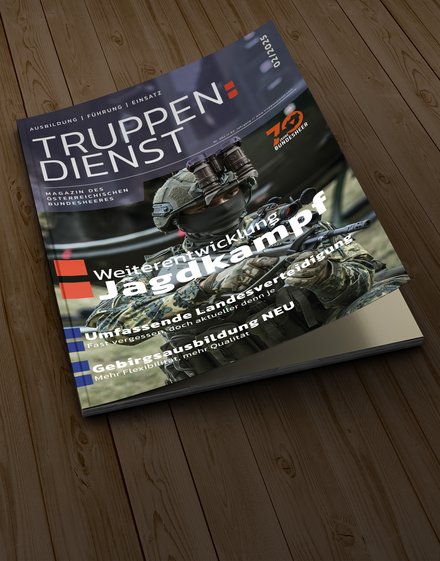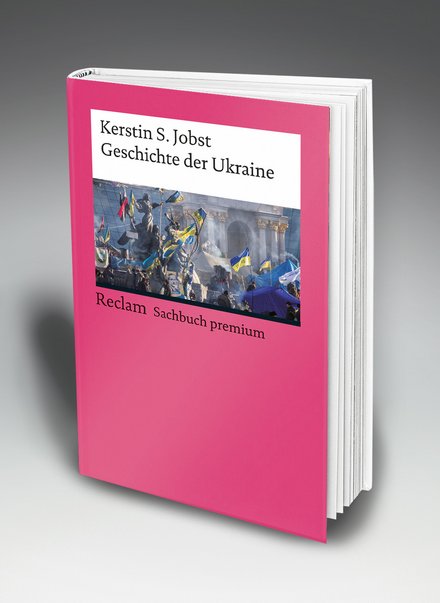1866: Am Ende war Königgrätz.

Orbán, Gábor:
1866: Am Ende war Königgrätz. Taktik und Strategie im preußisch-österreichischen Krieg (=Heere und Waffen 47)
Zeughaus Verlag: Berlin 2023,
ISBN: 978-3-96360-064-7,
39,95 €
Das Jahr 1866 war in der österreichischen Geschichte eine Zäsur. Kaiser Franz Joseph stand vor den Scherben seiner neoabsolutistischen Politik, er hatte zwei Kriege – 1859 gegen das Königreich Sardinien-Piemont und Frankreich, 1866 gegen Preußen und Italien – verloren, war aus dem Deutschen Bund hinausgedrängt worden und dann musste er der faktischen Teilung seines Reiches in einen „österreichischen“ und einen ungarischen Reichsteil zustimmen. Mit der Niederlage der Österreicher bei Königgrätz am 3. Juli 1866 war der Krieg faktisch entschieden. Aus einem Einheitsstaat wurde die österreichisch-ungarische Monarchie. Wie der Autor Gábor Orbán schon im Titel richtig festlegt, endete diese Entwicklung, die seit der Thronbesteigung von Franz Joseph 1848 begann, endgültig auf dem Schlachtfeld im Umfeld der Orte Sadová, Máslojedy und Chlum (Všestary).
Gábor Orbán legt mit diesem Buch eine umfassende Studie der politischen und militärischen Vorgeschichte des Krieges, eine Analyse von dessen genauen Ablauf, der Situation der Armee, des Kriegsschauplatzes und der taktischen sowie strategischen Ebenen vor, bevor er mit einem Resümee abschließt. Damit ist das Buch nicht nur eine Operationsgeschichte der Feldzüge in Böhmen und auch des italienischen Kriegsschauplatzes. Selbstredend ist auch die Seeschlacht bei Lissa (Vis) am 20. Juli 1866 ein Thema (Kapitel: „Der Waffengang“); die bereits in anderen militärhistorischen Werken genau ausgearbeitet wurde.
Der Autor beleuchtet den Krieg und seine Vorgeschichte auch in Bezug auf die Heereskunde und die dahinterstehenden militärpolitischen, taktischen und strategischen Konzepte der österreichischen Streitkräfte. Der Leser lernt das geographische Terrain in Böhmen, aber auch auf dem italienischen Kriegsschauplatz kennen, das „Innenleben“ der österreichischen Streitkräfte, ebenso ihre Bewaffnung und Uniformierung und kann sich damit ein umfassendes Bild darübermachen. Gerade diese Kapitel (ab Seite 83) sind für den Kenner des Heeres des alten Österreichs am Interessantesten, auch weil Gábor Orbán Vergleiche zu früheren Konflikten und auch zum viel größeren US-Amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 zieht.
So thematisiert er auch den rasanten Fortschritt in der Waffentechnik vom Vorder- zum Hinterlader und auch schon zum kommenden Repetiergewehr, das in den k. u. k. Streitkräften erst Jahrzehnte später kommen sollte. Wichtig ist ihm auch die Erläuterung des gezogenen Laufes, der damit einhergehenden Kompressionsgeschoße und die dazugehörenden Reglements für den Infanteriekampf und die Stoßtaktik. Die Reichweite der damals „modernen“, gezogenen Vorderlader – in Österreich vor allem die verschiedenen Versionen des Systems „Lorenz“ – hatten nicht nur Auswirkungen auf den Kampf der Infanterie, sondern auch auf die Rolle der Kavallerie.
Eigene Unterkapitel widmet der Autor der Versorgung und den – wie in den USA – so wichtigen Eisenbahnen, dem Nachrichtenwesen und der Artillerie. Wirft man einen Blick auf das verwendete Bildmaterial, so findet man zwar mehr Gemälde als Fotos, doch sind die Daguerreotypien im damaligen Österreich noch viel weniger verbreitet als etwa in den USA, wo Fotografen wie Mathew B. Brady tausende Aufnahmen machten und Zeichner von Zeitungen „Bilder in Action“ anfertigten, die dann in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Letztere hatten wohl im Kaiserreich noch nicht die gleiche Bedeutung wie auf der anderen Seite des Atlantiks.
Der „Deutsche Krieg“ ist immer wieder Thema in der historischen Forschung, jedoch ist das vorliegende Buch, das sich auf die österreichische Seite konzentriert, im wahrsten Sinn herausragend. Dies liegt nicht nur an dem breiten Themenkanon und die beiden Forschungsfragen – 1. Der napoleonische Kampfgeist im österreichischen militärischen Denken als Ursache der Niederlage und 2. Die Auswirkung der strategischen Defensive auf die taktische Offensive im Kontext der Niederlage – samt ihrer Beantwortung (Seiten 206 bis 209). Es ist auch der lesbare Schreibstil des Autors, seine genaue Auswertung der Quellen und Literatur, sein Verständnis für die damalige Waffentechnik und die Gefechtstechnik die heraussticht. Dazu lässt die Quellen- und Literaturliste nichts zu wünschen übrig.
Jeder, der sich mit dem Thema „Deutscher Krieg“ beschäftigt – oder sich darüber fachlich austauschen möchte –, sollte dieses Werk von Gábor Orbán genau lesen und seine Forschungsergebnisse genau verwerten. Am Schluss bleibt nur die Frage: Wann erscheint Gábor Orbáns Buch über den Sardischen Krieg 1859 bzw. eines über den Krieg gegen die ungarische Revolution 1848/49, die er ebenfalls auf diese Weise bearbeitet – denn: Königgrätz sollte nicht das Ende sein.
-mpr-