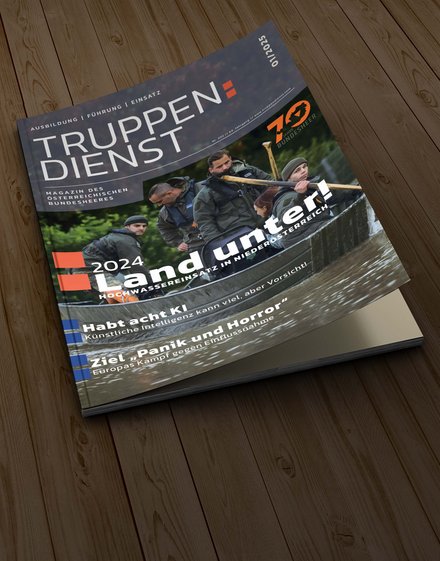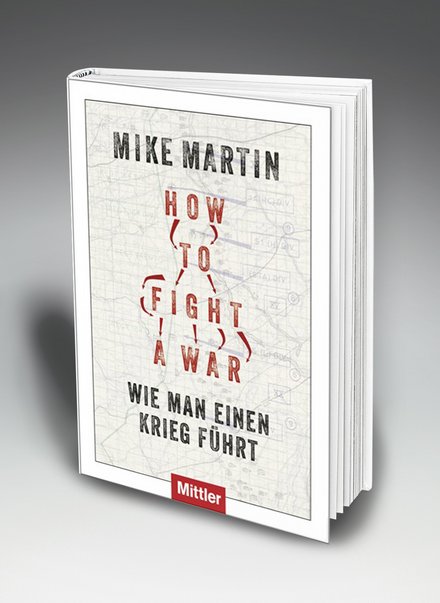Agent Orange & Co.

Die US-Streitkräfte setzten im Vietnamkrieg großflächig Entlaubungsmittel ein. Diese sollten dem Feind die Deckung des Dschungels nehmen und seine Nahrungsmittelproduktion stören. Dabei kamen extrem giftige Chemikalien zum Einsatz, die die gesamte Region belasten und bei allen Konfliktparteien – bis in die Gegenwart – zahlreiche Opfer fordern.
Von 1962 bis 1971 versprühten die US-Streitkräfte in etwa 6 000 Einsätzen mit 19 900 Einzelflügen nahezu 72 Millionen Liter Entlaubungsmittel (Herbizide) auf mindestens 5,5 Millionen Hektar Fläche in Südvietnam. Das entspricht etwa einer Menge von 1 800 Sattelschlepper-Tanklastwagen auf einer Fläche so groß wie Österreich ohne Tirol, Vorarlberg und Burgenland. Manche Quellen geben sogar ein Vielfaches davon an. In den Nachbarstaaten Laos und Kambodscha wurden solche Gifte ebenfalls eingesetzt. Ähnliche Herbizide wie auf diesem Kriegsschauplatz verwendeten die USA in den 1940er-Jahren ebenfalls im eigenen Land. So kamen sieben Herbizid-Formulierungen in unterschiedlichen Mengen zu verschiedenen Zwecken und Zeiten in mehreren Regionen zum Kriegseinsatz. Dabei entfielen 42 Millionen Liter allein auf das berühmteste Entlaubungsmittel – Agent Orange.
Bunte Namen
Die Agent-Namen entstanden, um im Militäralltag nicht komplizierte chemische Bezeichnungen verwenden zu müssen. Daher bezeichneten die US-Streitkräfte die einzelnen Entlaubungsmittel nach der jeweiligen Farbe des Farbstreifens, der auf den Lagerfässern lackiert war. So entstand der Begriff „Rainbow Herbicides“ mit den Agents Purple, Blue, Pink, Green, Orange, Orange II und White. So harmlos die Namen klingen, die enthaltenen Chemikalien sind extrem giftig. Etwa 65 Prozent aller Herbizide waren in unterschiedlichen Konzentrationen mit dem Gift „Dioxin“ (TCDD – Tetrachlordibenzodioxin; auch als Seveso-Gift bezeichnet) kontaminiert. Dadurch gelang es, die dichten Dschungel zu entlauben, um den Gegner besser aufklären zu können oder US-Militärbasen und Flugplätze durch entlaubte Sicherheitszonen vor Überfällen zu schützen. Die US-Streitkräfte besprühten auch Ackerflächen, um dem Gegner die Nahrungsgrundlage zu entziehen.
Etwa 86 Prozent der Einsätze erfolgten durch Absprühen aus der Luft. Aber auch Boote, Landfahrzeuge und tragbare Absprühvorrichtungen verteilten die Entlaubungsmittel. All dies führte zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsschäden bei der vietnamesischen Bevölkerung und bei jenen amerikanischen Soldaten, die an der Entlaubungsmission Operation „Ranch Hand“ beteiligt waren.
Operation „Ranch Hand”
Vorgeschichte
Das Vereinigte Königreich entwickelte militärische Entlaubungsmittel bereits während des Zweiten Weltkrieges. Es testete diese Chemikalien auf Basis von 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure unter dem Trivialnamen LN8, LN14, LN32 und LN33. Der Einsatz gegen das Deutsche Reich kam aufgrund des Kriegsendes nicht mehr zustande. Jedoch verwendeten die britischen Streitkräfte im „Malayan Emergency“-Kolonialkonflikt (1948 bis 1960) bereits Herbizide zur Bekämpfung chinesischer Partisanen in Malaysia. Diesen chemischen Einsatz betrachtete der damalige US-amerikanische Außenminister Dean Rusk als Präzedenzfall. Die USA stuften den Einsatz von Herbiziden in Vietnam nicht als chemische Kriegsführung ein und sahen darin folglich keinen Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht, zumal Herbizide auch in den USA selbst verwendet wurden.
Operation
Im Jahr 1960 beschränkte sich die amerikanische Militärassistenz in Südvietnam auf Militärberater sowie ökonomische und logistische Unterstützung mit weniger als 900 Soldaten. Doch die Gefahr einer Übernahme durch kommunistische „Vietkong“-Truppen Nordvietnams wuchs, und eine Entsendung amerikanischer Truppen stand bevor. Neben diversen Unterstützungsmaßnahmen wurde bereits der Einsatz von Entlaubungsmitteln erwogen. Ziel sollte sein, den dichten Bewuchs entlang von Bewegungslinien zu eliminieren, die dem Gegner als Hinterhalt dienten, um feindliche Militärbasen und Kommunikationslinien besser einsehen zu können, dem Gegner die Tarnung durch den dichten Dschungel zu nehmen und ihm die Nahrungsbasis zu entziehen.
US-Präsident John F. Kennedy autorisierte am 4. Dezember 1961 den Einsatz von Herbiziden. Am 12. Jänner 1962 flog die U.S. Air Force ihren ersten Einsatz im Rahmen der Operation „Ranch Hand“ drei Jahre vor dem Eintreffen erster amerikanischer Kampfverbände in Südvietnam. „Ranch Hand“ lieferte die ersten Erkenntnisse für die US Streitkräfte mit chemischen Entlaubungsmitteln in großem Maßstab.
Entlaubungseinsätze
Die Sprüheinsätze hatten ursprünglich zwei Ziele: Zum einen sollten Bäume und Pflanzen entlaubt werden, um die Sicht bei US-Militäroperationen zu verbessern und zum anderen sollte die Nahrungsmittelproduktion des Gegners gestört werden. Angriffsziele der ersten Entlaubungsoperationen waren Militärbasen, Feuerstellungsräume, Kommunikationseinrichtungen sowie mögliche Annäherungslinien des Gegners zur Infiltration und feindliche Militärbasen.
Hubschrauber zur Entlaubung
Die Entlaubungsoperationen per Luft flogen ausschließlich „Ranch Hand“-Besatzungen. Dazu standen vornehmlich die Flächenflugzeuge „Fairchild“ C-123 und die Helikopter Bell UH-1 „Iroquois“ („Huey“) sowie Sikorsky H-34 „Huss“ zur Verfügung. Von 1967 bis 1968 war die Anzahl der Entlaubungseinsätze derartig hoch, dass auch andere Helikoptertypen die Besprühung kleinerer Zonen, wie mögliche Hinterhalte oder lokale Militärbasen, übernehmen mussten. Von 1970 bis 1971 übernahmen Flugzeuge beinahe alle Herbizid-Einsätze.
1965 erhöhte sich die Anzahl der C-123-Maschinen von drei auf zwölf, bis 1971 auf insgesamt 36 Maschinen. Lag die Anzahl der Entlaubungseinsätze 1962 noch bei 107 pro Jahr, erhöhte sie sich bis 1967 auf 1 600. Üblicherweise wirkten drei bis vier Maschinen an einer Mission mit, später waren sogar bis zu 19 Luftfahrzeuge daran beteiligt. Wurde der Einsatz durch ein einziges Flugzeug geflogen, nannte man dies „Sortie“ (Ausflug).
Gefährliche Sprüheinsätze
Unter normalen Bedingungen flogen die C-123-Flugzeuge mit einer Geschwindigkeit von etwa 240 bis 280 km/h in einer Höhe von ungefähr 45 Metern. Damit erreichte die Sprühwolke eine Breite von rund 240 Metern. So konnte mit einem 4 000-Liter-Tank in drei bis fünf Minuten 140 Hektar in einer Länge von etwa 14 Kilometern besprüht werden. Die Ablagerungsrate wurde mit zwölf Litern pro 4 000 m² berechnet. Aufgrund der niedrigen Flughöhe und -geschwindigkeit waren die „Ranch Hand“-Flugzeuge leicht vom Boden aus zu bekämpfen. Daher sicherten ab 1963 zunehmend Kampfflugzeuge die Herbizideinsätze. Die Luftfahrzeuge verfügten über „Helicopter Insecticide Dispersal Apparatus, Liquid“ (HIDAL). Sie hatten ein Fassungsvermögen von etwa 750 Litern, allerdings wurden aus Gewichtsgründen nur 380 Liter abgefüllt. Bei einer Fluggeschwindigkeit von circa 100 km/h erreichte die Sprühwolke eine Breite von 75 Metern. Damit verteilten sich ungefähr sechs Liter Herbizid auf 4 000 m². Zusätzlich beeinflussten meteorologische Bedingungen wie Wind und Temperatur, Gelände und durch das Luftfahrzeug verursachte Turbulenzen die Verteilung. Dem gegenüber standen lediglich zehn Prozent der Herbizideinsätze, die von Land mit mobilen Zerstreuungsgeräten (Dispersionssystemen) durchgeführt wurden.
Gefahr erkannt
Im Jahr 1969 war in Vietnam die Hälfte des anbaufähigen Landes besprüht. Etwa ein Zehntel der betroffenen Bäume starb ab. In Bereichen, die mehrmals besprüht wurden, betrug das Waldsterben 50 bis 80 Prozent. 80 Prozent der Herbizide, die bei „Ranch Hand“ zur Anwendung kamen, wurden zwischen 1966 und 1969 ausgebracht. Bereits 1964 kritisierte die Federation of American Scientists den Einsatz von Herbiziden wegen deren Giftigkeit. 1969 gab das US-Department of Defense vor, die Herbizide nur noch in Gegenden einzusetzen, die weitab von der Bevölkerung liegen. Grundlage hierfür war die Erkenntnis des „National Institutes of Health“, wonach 2,4,5-T Missbildungen und Totgeburten bei Mäusen verursachte. Die American Association for the Advancement of Science bestätigte die Studie und weitete sie auf 2,4-D aus, wobei vor allem die Dioxin-Verunreinigung im 2,4,5,-T bedeutend ist, weil 2,4-D im Verdacht steht, krebserregend zu sein.
Das Programm „Ranch Hand“ wurde 1970 eingestellt. Das letzte Sprühflugzeug mit Agent Orange startete am 7. Jänner 1971. 1973 hatte die U.S. Air Force noch etwa 8,8 Millionen Liter Herbizide übrig. Diese Vorräte wurden 1977 an Bord des Verbrennungsschiffes „Vulcanus“ auf See verbrannt. Experten schätzen die durch Herbizide freigesetzten reinen Dioxin-Mengen in Vietnam zwischen 106 und über 366 Kilogramm.
Krieg im Krieg
Ab 1965 kristallisierte sich in Südvietnam ein neuer Feind heraus: Die Anopheles-Mücke. Trotz einiger prophylaktischer Maßnahmen erkrankten etwa 50 Prozent der US-Soldaten, die im Dschungel eingesetzt waren, an Malaria. Das „Department of Defense“ autorisierte den Einsatz von Herbiziden. Von Oktober 1966 bis Dezember 1971 flogen die „Ranch Hand“-Flugzeuge auch Insektizideinsätze. Die Operation „Flyswatter“ (Fliegenklatsche) war die Antwort auf die Malaria-übertragenden Insekten. Die Silver Bugs flogen im Jahr 1967 etwa 20 Sorties pro Tag. Ein Sortie deckte etwa 6 000 Hektar ab. Verwendet wurden dabei die Insektizide Malathion und DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan), die vorwiegend auf eigene und alliierte Militärbasen abgesprüht wurden. Der „Krieg gegen die Moskitos“ erforderte über 1 300 Einzelmissionen. Mit 1,76 Millionen Liter Malathion wurden insgesamt etwa 44 Prozent Südvietnams besprüht.
Die „Rainbow-Herbizide“
Die in der Operation „Ranch Hand“ verwendeten Herbizide wurden der Einfachheit halber nach der Farbkennzeichnung benannt, welche die 200-Liter-Fässer trugen. Im Wesentlichen handelte es sich um sieben chemische Formulierungen:
Agent Purple
Es war das erste Herbizid, das von den US-Streitkräften in großem Maßstab für Entlaubungsaktionen bei Camp Drum, New York, getestet wurde. Es handelt sich um eine 50:30:20 Mischung aus 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D), 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) und 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure-iso-Butylester. Agent Purple enthielt mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Dioxin als Agent Orange. Aufgrund seiner hohen Volatilität wurde es nur lokal eingesetzt, führte hier aber zu hohen Dioxin-Kontaminationen. 1965 wurde Agent Purple durch Agent Orange ersetzt.
Agent Blue
Es ist ein wässriges Gemisch aus Dimethylarsinsäure (Cacodylsäure) und dessen Natriumsalz Natriumdimethylarsinat und wurde während des gesamten Vietnamkrieges vorwiegend zur Vernichtung von Gräsern und Reis verwendet. Vorerst wurde es im Feld mit Wasser aufbereitet, später kam die fertige Lösung als „Phytar 560-G“ zur Anwendung. Es wurde vor allem in Operationen eingesetzt, die eine rasche Vernichtung der Pflanzen erforderten.
Agent Pink
Dieses Herbizid wurde oftmals als Mischung mit dem chemisch stark verwandten Agent Green eingesetzt. Beide enthielten als Wirkstoff den n-Butylester der 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) und setzten mehr Dioxin als Agent Orange frei. Sie wurden zwischen 1962 und 1964 eingesetzt und von Agent Orange abgelöst.
Agent White
Hinter dieser Bezeichnung stand das Produkt „Tordon 101“, das 2,4-D und Picloram als Wirkstoffe enthielt. Es wurde vor allem wegen des Mangels an Agent Orange zur Entlaubung von Wäldern eingesetzt. Seine langsame Wirkung (mehrere Wochen) wurde als nachteilig angesehen.
Agent Orange
Agent Orange I und Agent Orange II, auch „Super Orange“ genannt, sind die wohl bekanntesten Herbizide, die während der Operation „Ranch Hand“ in Vietnam abgesprüht wurden. Sie zählen zu den Wuchsstoffen. Diese regen zum schnellen Wachstum an, so dass die betroffenen Pflanzen nicht mehr mit der Nahrungsmitteleigenversorgung nachkommen. Neben den Wirkstoffen 2,4-D und 2,4,5-T enthält Agent Orange das Dioxin TCDD, das für die immensen Schäden an Menschen und Natur hauptverantwortlich ist. TCDD ist unter anderem seit dem 1976 in Seveso, Italien, stattgefundenen Chemieunfall unter dem Namen „Seveso-Gift“ (siehe „Seveso-Unfall“) bekannt und wird als „Dioxin“ bezeichnet.
Seveso-Unfall 1976
Am Samstag, dem 10. Juli 1976, ereignete sich in der Chemiefabrik ICMESA im italienischen Meda, etwa 20 km nördlich von Mailand, ein Betriebsunfall. Dabei gelangte eine bis heute unbekannte Menge Dioxin (TCDD; 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin) in die Umwelt. Quellen geben Werte zwischen einigen 100 Gramm und einigen Kilogramm an. Mehr als 700 Personen mussten evakuiert werden. Zahlreiche vergiftete Häuser wurden abgerissen, großflächige Dekontaminationsarbeiten waren erforderlich. 1 800 Hektar galten als höchst kontaminiert, 78 000 Tiere mussten gekeult werden. In der unmittelbar um das Industriewerk betroffenen Zone A verendeten Tiere, weil die Dioxin-Belastung des Bodens über 50 Mikrogramm pro Quadratmeter betrug. Etwa 300 Personen litten in unmittelbarer Folge an Chlorakne. Direkte Todesfälle werden der Katastrophe nicht zugeordnet. Allerdings stellten Ärzte in den folgenden Jahren ein erhöhtes Auftreten bestimmter Krebsarten fest. Der Seveso-Unfall führte zusammen mit ähnlichen Vorkommnissen zur Störfallrichtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) zur Verhütung schwerer Betriebsunfälle mit gefährlichen Stoffen und zur Begrenzung der Unfallfolgen.
Dioxin
Dioxine bzw. chemisch verwandte Stoffe gehören zu den giftigsten organischen Verbindungen. Die letale Dosis beim Menschen ist nicht bekannt. Im Tierversuch lag die tödliche Dosis bei Tieren zwischen 0,5 (Meerschweinchen) und 1 157 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht (Hamster). Kontakt mit Dioxinen wie TCDD kann Chlorakne auslösen. Sie gilt als Symptom einer schweren Dioxinvergiftung. Eine solche Vergiftung kann zu schweren Organschäden, insbesondere der Leber, führen. Eine Schädigung des Erbgutes ist nicht eindeutig nachgewiesen – ebenso die Frage, ob Dioxine Missbildungen beim Nachwuchs auslösen können. Sicher ist hingegen, dass Dioxine Krebs verursachen können.
Über Nahrungsmittel, vor allem Fleisch, Milch und Fisch, können Dioxine in den menschlichen Körper gelangen, wo sie sich vorwiegend im Fettgewebe festsetzen. Der Körper braucht Jahre, um seine Dioxin-Belastung wieder zu reduzieren. Insgesamt sind rund 210 Dioxin-Verbindungen bekannt.
Terrorwaffe Dioxin
Dioxine erregten im Jahr 2004 wieder internationale Aufmerksamkeit: Im September 2004 erlitt der ukrainische Politiker Viktor Juschtschenko eine Dioxinvergiftung, die sein Gesicht entstellte und seine Organe lebensgefährlich angriff. Am Vorabend hatte er sich zu einem Essen mit dem Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes und dessen Stellvertreter getroffen. Die erfolgreiche Behandlung und letztlich die Bestätigung der Aufnahme einer extrem hohen Dosis von Dioxin erfolgte schließlich in Österreich – durch Experten der Wiener Rudolfinerhaus Privatklinik.
Folgen
Aufgrund seiner chemischen Beständigkeit bleibt TCDD lange in der Umwelt. An der Oberfläche verweilt es etwa ein bis drei Jahre, in Sedimenten mehr als 100 Jahre. Die Kontamination wird über Flüsse, mit dem Wind und durch die Bodenerosion vertragen. TCDD gelangt auf diesem Weg in die Nahrungskette des Menschen. 2019 schätzten Agrarforscher, dass die Vergiftung des Bodens in Vietnam noch mehrere Jahrzehnte anhalten wird.
Als in den 1960er-Jahren der Zusammenhang zwischen TCDD und Gesundheitsschäden wissenschaftlich belegt wurde, klagten betroffene US-Soldaten die Herstellerfirmen. Im Zuge eines außerordentlichen Vergleiches richteten mehrere Chemiefirmen einen Fonds für Entschädigungszahlungen für ehemalige US-Soldaten ein. Vietnamesische Opfer brachten ebenfalls eine Klage gegen die Herstellerfirmen ein, die 2005 abgewiesen wurde. Die Begründung: Agent Orange sei kein Mittel der chemischen Kriegsführung, daher habe dessen Einsatz nicht gegen geltendes internationales Recht verstoßen.
Laut der „Vietnamese Association of Victims of Agent Orange“ leiden etwa drei Millionen Vietnamesen an den Spätfolgen der Herbizideinsätze. Diese sind Fehlbildungen, Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten, Immunschwächen und unterschiedliche Krebsarten. Die Organisation schätzt, dass durch die Vergiftung 150 000 Kinder genetische Defekte haben. In manchen vietnamesischen Städten wurden Opfer der Operation „Ranch Hand“ konserviert und in Museen ausgestellt. Seit 2009 erinnert der „Agent Orange Day“ jährlich am 10. August an die Opfer des giftigen Herbizides.
Umweltkriegsübereinkommen
Herbizide finden sich nicht in den Listen der Chemiewaffenkonvention. Dennoch ist ihr Einsatz nach dem UN-Umweltkriegsübereinkommen, der ENMOD Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, geregelt. Dieser völkerrechtliche Vertrag wurde von der Abrüstungskommission der Vereinten Nationen nach den Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg verfasst. Er verbietet die militärische oder sonstige feindselige Nutzung umweltverändernder Techniken. So untersagt er den Vertragsparteien gezielte militärische Eingriffe in natürliche Abläufe der Umwelt, aber auch die Nutzung von Einflüssen der natürlichen Umwelt als Waffe in einem Krieg oder bewaffneten Konflikt. Diese Konvention verknüpft Umweltrecht mit Humanitärem Völkerrecht. Der Schutz der natürlichen Umwelt vor den Auswirkungen durch Kampfhandlungen wurde 1977 durch das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen bekräftigt. Mit Stand von 2022 sind 78 Staaten Vertragspartei, weitere 16 haben unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Österreich ist seit 17. Jänner 1990 Vertragspartei.
Fazit
Jahrzehnte nach dem Vietnamkrieg vergiften „Agent Orange“ und Co. noch immer Mensch und Natur. US-Veteranen erhielten Entschädigungen, die Klagen der betroffenen vietnamesischen Bevölkerung wurden abgewiesen. Drei Millionen Menschen, davon 150 000 behinderte Kinder sind betroffen. Das belastende Erbe bleibt weiter bestehen. Das Wiederherstellen der Natur kommt nur langsam in Gang. Die Tragik des Herbizideinsatzes liegt nicht nur in den direkt verursachten Folgen und in den langanhaltenden, weder kontrollierbaren noch unmittelbar nachweisbaren Folgen für die Nachkommen der zweiten und dritten Generation, sondern auch im (un-)moralischen Aspekt der Aufarbeitung.
Oberrat Oberst dhmfD Erwin Richter, MA; Leiter des Referates höhere Fachausbildung & Wissensmanagement am ABC-Abwehrzentrum

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 1/2025 (402).