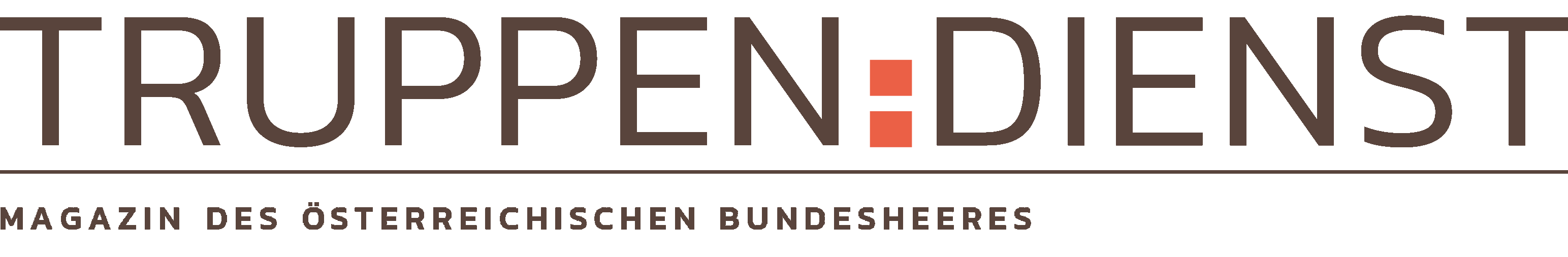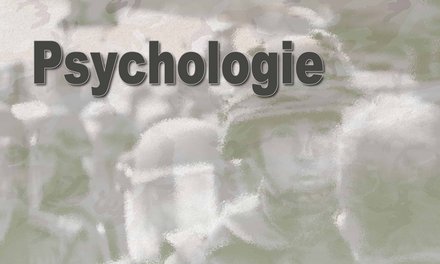- Veröffentlichungsdatum : 02.01.2019
- – Letztes Update : 20.12.2018
- 15 Min -
- 3080 Wörter
- - 8 Bilder
Der Beginn der Republik: Die Volkswehr 1918 bis 1920
Nicht Revolution, sondern Sezession

In Wien war man 1918/19 bemüht, zu ein- und derselben Zeit ein Heer abzubauen - zu demobilisieren - und ein anderes aufzubauen, neu zu rekrutieren. Das alte Heer der Monarchie wurde zum Teil sogar als Gefahr gesehen. Mit dem politischen Zerfall der Monarchie drohte sich auch die militärische Ordnung aufzulösen.
Österreich befand sich 1918 in einer einzigartigen Situation. Das Deutsche Reich hatte den Krieg zwar ebenfalls verloren und eine Revolution durchgemacht, aber die Institutionen von Staat und Armee waren erhalten geblieben. In Österreich war das anders. Es wurde nicht bloß die Monarchie in eine Republik umgewandelt, sondern der Staat zerfiel. Die „Nachfolgestaaten“ sagten sich von der übernationalen Habsburgermonarchie los. Sie übernahmen Teile ihres Gebietes und Bruchteile der alten Verwaltung, lehnten aber jede Kontinuität mit Österreich-Ungarn ab. Das galt für Deutschösterreich genauso wie für die Tschechoslowakei, die die „Entösterreicherung“ offiziell auf ihr Programm schrieb. Österreich, das war nicht die „Alpenrepublik“, wie sie uns heute vertraut ist, sondern der alte übernationale Staat. Die Deutschen dieses alten Österreichs, und dies umfasste die Sudetendeutschen damals noch genauso wie die Südtiroler, wollten jetzt ebenfalls ihren eigenen Staat gründen. Die deutschen Abgeordneten des alten Reichsrates konstituierten sich im Sinne des Völkermanifestes Kaiser Karls, als „provisorische Nationalversammlung“, die am 30. Oktober einen Staatsrat wählte.
Nach dem Waffenstillstand mit Italien am 3./4. November 1918 strömten hunderttausende Soldaten in die Heimat zurück. Sie alle, auch die Tschechen und Slowaken, Polen und Ukrainer, mussten dabei die Alpenregionen durchqueren, ohne dass man dafür irgendwelche Vorbereitungen getroffen hatte. Noch dazu war die Versorgungslage katastrophal. In Tirol und Kärnten machte sich deshalb schon Ende Oktober große Besorgnis vor Plünderungen und Übergriffen breit. Die Bestimmung, dass Truppen, die deutschösterreichisches Gebiet durchquerten, vorher ihre Waffen abzugeben hatten, ließ sich nicht durchsetzen. Im Gegenteil: Entlang der Bahnlinien, in Innsbruck, Linz oder Stadlau, kam es im November 1918 immer wieder zu Zusammenstößen, die sogar Todesopfer forderten. In Wien und in den Industriezentren gab es außerdem die Furcht vor revolutionären Unruhen, die ihren Ausgang teilweise von radikalisierten Ersatzeinheiten der alten Armee nahmen, wo sich nach dem Vorbild der Russischen Revolution „Soldatenräte“ bildeten, die die Führung an sich gerissen hatten.
Um all diesen Bedrohungen entgegenzutreten, griff die Bevölkerung vielfach zur Selbsthilfe. Unter verschiedenen Bezeichnungen bildeten sich spontan unterschiedliche Selbstschutzverbände, vielfach unterstützt von Aufrufen der lokalen Behörden und Bürgermeister. Staatskanzler Renner berichtete am 30. Oktober der provisorischen Nationalversammlung: „In der Bevölkerung selbst erschallt der lebhafte Ruf nach Organisierung von Bürgergarden und Nationalgarden. Das Bedürfnis ist dringend und wir dürfen uns dadurch nicht überholen lassen.“ Der Wildwuchs bewaffneter Verbände barg ebenfalls Gefahren für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das Gewaltmonopol des Staates sollte gewahrt werden. Die Nationalversammlung beschloss daher, „dass die Organisation der bewaffneten Macht ausschließlich Aufgabe der Staatsgewalt ist und daher kein Privater das Recht besitzt, Nationalgarden zu bilden oder zu ihrer Bildung aufzurufen.“ Wenn Landesregierungen oder Gemeinden Bürgergarden aufstellen wollten, müssten sie dafür die Genehmigung des Staatsrates einholen. So richtete das Innenministerium, zusammen mit der Wiener Stadtverwaltung, damals für kurze Zeit beide noch in christlichsozialer Hand, eine Stadtschutzwache ein, die bald an die 2.000 Mann umfasste, darunter auch eine jüdische Legion.
Die Volkswehr als Notbehelf
Der Staatsrat hatte am 30. Oktober ein Staatsamt für Heerwesen eingerichtet, mit dem deutschnationalen Agrarier Josef Mayer an der Spitze, und jeweils einem Unterstaatssekretär aus den Reihen der Christlichsozialen und der Sozialdemokraten, Erwin Waihs und Julius Deutsch. Als Oberbefehlshaber wurde Feldmarschallleutnant Adolf von Boog angelobt, ein Offizier, dem die Sozialdemokraten zubilligten, er sei ein „guter Deutscher, der auch ein reges soziales Empfinden an den Tag lege.“ Politisch lief Boog in den turbulenten Zeiten allerdings Gefahr, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Jedenfalls trat er bereits Ende Mai 1919 zurück, möglicherweise, weil sein Plan für die Aufstellung von Freiwilligenverbänden zur Gewinnung des Burgenlandes abgelehnt worden war. Der Posten des Oberbefehlshabers wurde nicht neu besetzt.
Parteipolitische Taktik und Interessen verbanden sich in den kommenden Monaten mit den Erfordernissen, die sich aus den historischen Umständen ergaben. Die wesentliche Rolle beim Aufbau der bewaffneten Macht kam zweifellos Julius Deutsch zu, der über einschlägige Erfahrungen verfügte, weil er schon in den letzten Monaten der Monarchie als Verbindungsmann zwischen der Arbeiterschaft und dem Kriegsministerium tätig gewesen war. Nach den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung im Februar 1919, bei der die Sozialdemokraten eine relative Mehrheit erreichten, übernahm Deutsch die Führung des Heeresressorts. Deutsch war zweifellos ehrlich um die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bemüht. Seine Devise war, dass auch die Revolution nicht in der Anarchie untergehen dürfe.
Ursprünglich sollte pro Bezirk ein - allerdings schwaches, nur ca. 400 Mann starkes - Bataillon errichtet werden. Auf dem Lande wurde oft nicht einmal dieser Stand erreicht, in Teilen Wiens dafür „übererfüllt“. Hier zählte die Volkswehr, wie das neue Heer heißen sollte, Ende 1918 schon 35 Bataillone mit fast 20.000 Mann. Die Volkswehr setzte sich allein deshalb schon - ohne dass es dafür irgendwelcher Personalpolitik von oben bedurft hätte - überwiegend aus Anhängern der Sozialdemokratie zusammen - oder aus Elementen, die noch weiter links standen, wie z. B. die „Rote Garde“, die bei der Ausrufung der Republik am 12. November 1918 vor dem Parlamentsgebäude einen Krawall provozierte.
Im Februar 1919 wurde dann noch schnell ein provisorisches Wehrgesetz verabschiedet. Man war sich der Schwierigkeiten bewusst. Die Volkswehr sollte nur 24.000 Mann umfassen. Die Wehrpflicht wurde beibehalten, doch stark eingeschränkt: Die Dienstzeit sollte nur vier Monate betragen, so dass z. B. Bauern ihren Dienst im Winter, Studenten dafür in den Sommerferien ableisten könnten. Vier Monate waren zu wenig zur Ausbildung: Eingezogen werden sollten daher Jahrgänge, die noch während des Krieges gedient hatten, aber niemand, der schon mehr als zwei Jahre an der Front gestanden hatte. Man war sich keineswegs sicher, ob man mit dieser „Wehrpflicht light“ genügend Mannschaften zusammenbekommen würde. Solange das nicht der Fall war, wollte man deshalb Freiwillige anwerben, was in der Praxis dann meistens auch geschah.

Die Situation verschärfte sich, als am 21. März 1919 in Ungarn die Kommunisten die Macht übernahmen und eine „Räterepublik“ ausriefen. Im April folgte eine Räterepublik in München (in der in untergeordneter Position damals auch noch der Gefreite Adolf Hitler diente). Deutschösterreich schien von beiden Seiten her in die Zange genommen zu werden. Das Burgenland war damals noch ungarisch, Wiener Neustadt deshalb eine Grenzstadt und Wien nur zwanzig Kilometer von der Grenze entfernt. Die kleine Kommunistische Partei Österreichs erhielt regen Zulauf und zählte bald 40.000 Mitglieder. Die österreichische Sozialdemokratie war allerdings gegen revolutionäre Experimente, nicht zuletzt deshalb, weil man sich im Klaren war, dass die siegreichen Entente-Mächte eine Machtübernahme durch das Proletariat nicht dulden würden. Man hatte deshalb von Anfang an versucht, die Rätebewegung, die sich nicht mehr aufhalten ließ, in geordnete Bahnen zu lenken. Schon für den 3. November war die offizielle Wahl von Soldatenräten ausgeschrieben worden. Die radikalen Elemente wollte man kontrollieren, indem man sie in die regulären Streitkräfte eingliederte, wie z. B. das berüchtigte Volkswehrbataillon 41, das sich aus Angehörigen der „Roten Garde“ zusammensetzte.
Im Laufe des Frühjahres verdichteten sich die Gerüchte, dass die ungarische Räteregierung einen Putsch in Österreich in Szene setzen wolle. Der sozialdemokratische Innenminister Matthias Eldersch ermächtigte deshalb Polizeipräsident Schober am 14. Juni zur Verhaftung der kommunistischen Führung. Daraufhin fand am nächsten Tag eine Kundgebung der Kommunistischen Partei statt; die Teilnehmer wandten sich gegen das Polizeipräsidium in der Rossauer Kaserne. In der Hörlgasse kam es zu einer Schießerei, die zwanzig Tote forderte. Die Volkswehr erfüllte ihre Pflicht. Selbst das misstrauisch beäugte Volkswehrbataillon 41 rückte nicht zur Unterstützung der Demonstranten aus (Es wurde nach dem Ende der ungarischen Räterepublik im August dennoch aufgelöst).
Die Strategie von Julius Deutsch, die Wilderer zu Förstern zu machen und ihnen Sold gegen Wohlverhalten anzubieten, hatte sich bewährt. Aber die Bürgerlichen trauten dem Frieden nicht. Erstmals wurden damals Überlegungen laut, die Nationalversammlung eventuell nach Innsbruck zu verlegen. Die niederösterreichischen Bauern veranstalteten zwei Wochen nach den Zwischenfällen vom 15. Juni einen „Landesbauerntag“ in Wien, mit einem Aufmarsch von Zehntausenden, der als Machtdemonstration der konservativen Landbevölkerung gedacht war.
Die Kämpfe um die Grenzen der Republik
Die Grenzen des neuen Staates wurden erst im Vertrag von St. Germain im Oktober 1919 endgültig festgelegt. Bis dahin war eine Reihe von Gebieten zwischen den Nachfolgestaaten umstritten. Von der Größenordnung her war das Problem der Zugehörigkeit der sudetendeutschen Gebiete die mit Abstand drängendste Frage. Doch ein Kampf gegen tschechoslowakische Verbände hätte leicht als Bruch des Waffenstillstandes ausgelegt werden können, denn die Tschechoslowakei war von der Entente noch während des Krieges als verbündete Macht anerkannt worden. So reichte ein einziger Hauptmann in der Uniform der Tschechoslowakischen Legion aus, um die Deutschösterreicher zur kampflosen Übergabe von Städten wie Leitmeritz zu zwingen, dem Sitz des alten Korpskommandos in Böhmen, wo Deutsche und Tschechen eine Zeitlang gemeinsam Ordnungsdienst versehen hatten.
Nur im Süden lagen die Dinge zum Teil anders, denn da handelte es sich bei den gegnerischen Kräften, zumindest in den ersten Wochen, ebenfalls um schnell zusammengestellte Einheiten aus dem Reservoir der alten Armee. Jugoslawien wurde von der Entente erst im Sommer 1919 anerkannt. Hier konnte die Wiener Regierung deshalb zur Sprachregelung greifen, die gegnerischen Freischärler müssten offizielle Aufträge alliierter Kommanden vorweisen, um als Entente-Truppen anerkannt zu werden. Innerhalb dieser Grauzone war die Möglichkeit für einen Kärntner Abwehrkampf gegeben, an dem sich auch staatliche Formationen beteiligen durften. Nach der Jahreswende 1918/19 beschränkte sich die deutschösterreichische Seite jedoch auf das Halten der vereinbarten Demarkationslinien. So verbot die Wiener Regierung im Februar allen untergeordneten Stellen die Beteiligung an einem Versuch steirischer Bauern, die Stadt Radkersburg zurückzuerobern. Auch die Überlegung, die Zufuhr von Lebensmitteln aus dem südslawischen Raum nicht zu gefährden, spielte dabei eine Rolle. Wien unterstützte jedoch die Verteidigung gegen den südslawischen Großangriff in Kärnten ab Ende April 1919. Zwar führte das massive Engagement serbischer Verbände im Juni 1919 noch zum Verlust Klagenfurts. Aber eine amerikanische „fact finding mission“ hatte inzwischen bereits die Weichen für die Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 gestellt.
Ein eigenes Problem stellte die Forderung nach der Angliederung von Deutsch-Westungarn (Burgenland) dar, das zu einem Zankapfel mit dem ehemaligen Partner innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde. Solange in Ungarn die kommunistische „Räterepublik“ herrschte, liebäugelten die Bürgerlichen mit einem Einmarsch in das umstrittene Gebiet, im August 1919. Durch die Gegenrevolution triumphierten die Sozialdemokraten - doch schließlich wollte niemand eine größere militärische Auseinandersetzung riskieren. Nach dem Abschluss der Friedensverträge 1919/20 kam es unter Vermittlung Italiens dann zu einem Kompromiss. Das Burgenland fiel an Österreich. In Ödenburg (Sopron) und seiner Umgebung aber wurde 1921 eine Volksabstimmung durchgeführt, die für Ungarn ausgehen sollte.
Von der Volkswehr zum Bundesheer
Inzwischen waren Anfang Juni 1919 auch schon die Friedensbedingungen bekannt geworden, die Deutschösterreich im Vertrag von St. Germain auferlegt werden sollten. Neben den Gebietsverlusten (Sudetengebiete, Südtirol, Untersteiermark) befanden sich darunter auch klare Vorgaben für das Heerwesen. Man hatte in Österreich bisher immer mit einer Milizarmee als Ideallösung gerechnet. Doch die allgemeine Wehrpflicht wurde Österreich - genauso wie dem Deutschen Reich und Ungarn - verboten. Die Besiegten sollten ihre wehrfähigen Mannschaften nicht weiterhin kriegsmäßig ausbilden dürfen. Es blieb deshalb bei einer Berufsarmee, die maximal 30.000 Mann stark sein durfte, davon höchstens 1.500 Offiziere und 2.000 Unteroffiziere. Um eine Umgehung der Bestimmungen durch häufigen Personalwechsel vorzubeugen, mussten Mannschaften sechs Jahre dienen, maximal fünf Prozent durften pro Jahr ausscheiden. Auch für die Bewaffnung gab es Vorschriften: Das Verbot von U-Booten traf Österreich inzwischen vielleicht nicht mehr allzu hart, sehr wohl aber das Verbot von Panzern und Flugzeugen (von denen sich Anfang 1919 immerhin noch fast 700 auf dem Gebiet der Republik befanden). Die Zahl der Geschütze wurde mit maximal 90, die der Maschinengewehre mit maximal 450 beschränkt. Um den Ablieferungsbestimmungen ein Schnippchen zu schlagen, verschwand ein ansehnlicher Teil der Waffen der alten Armee in diversen Verstecken (in der Steiermark sogar ein halbes Dutzend Flugzeuge).
Inzwischen war die Volkswehr von 5.000 Mann Ende November 1918 auf über 50.000 im Frühjahr 1919 angeschwollen. Die Arbeitslosigkeit des Jahres 1919 - die bald von der Scheinkonjunktur der Inflationsjahre abgelöst wurde - hatte ihre Attraktivität erhöht. Die Entente verlangte eine Reduktion der Stände. Die bürgerlichen Parteien machten sich diese Forderung zu eigen. Die Volkswehr hatte sich zwar loyal verhalten, aber auch unbeliebt gemacht, weil sie immer wieder Requisitionen von Lebensmitteln durchführte - denn die Ablieferungsbestimmungen der Kriegsjahre waren weiterhin in Kraft. Hier machte sich ein Stadt-Land-Konflikt bemerkbar. In der Oststeiermark kam es zwischen der Volkswehr und der Landbevölkerung sogar zu einer stundenlangen Schießerei. Vielen Bauern galt die Volkswehr als ein „Volksübel“, das nur „dem Stehlen und dem Raub“ diene. Der christlichsoziale Staatssekretär für Landwirtschaft Josef Stöckler rief seine Bauern deshalb sogar zur Bildung von Flurwehren auf.
Bisher hatte die Volkswehr als Übergangslösung gegolten. Jetzt war Österreich die Beibehaltung des Berufs- und Freiwilligenheeres vorgeschrieben worden. Damit erhielt die Frage, wer in diese Armee aufgenommen werden sollte, eine ganz andere Bedeutung. Die Sozialdemokraten hatten sich um die Abwehr der Bedrohung von links unzweifelhaft große Verdienste erworben. Doch diese Bedrohung gehörte inzwischen der Vergangenheit an. Die ungarische Räterepublik war im August zusammengebrochen, die Münchner schon vorher. Die bürgerliche Mehrheit des Parlamentes wollte nicht auf Dauer mit einem Heer leben, von dem Otto Bauer seitens der Sozialdemokratie offen zugab: „Man hat gesagt, wir hätten uns auf diese Weise eine Parteitruppe geschaffen. Das will ich gar nicht leugnen.“ Die Christlichsozialen und die oppositionellen Deutschnationalen nahmen deshalb schon im Laufe des Herbstes 1919 Verbindung auf, um der Volkswehr ein anderes Gesicht zu verleihen. Vor allem war es ihnen ein Anliegen, den Schwerpunkt der Rekrutierung in die Länder zu verlegen. In dieser Föderalisierung der Armee sollten nur mehr „Landeskinder“ aufgenommen werden - ausdrücklich „Unbescholtene“, denn angeblich war der Anteil der bisherigen Volkswehrangehörigen mit Vorstrafen kein geringer.
Doch woher sollte man das Personal für eine Alternative nehmen? Der Christlichsoziale Leopold Kunschak warnte seine Parteifreunde. „Vom Soldatenspielen will niemand mehr etwas wissen.“ Freilich, es gab eine Ausnahme von dieser Regel: Die Offiziere und Unteroffiziere der alten Armee. Von den Offizieren der alten Armee waren nicht weniger als 16.000 in Deutschösterreich beheimatet. Kaiser Karl hatte ihnen den Eintritt in die Streitkräfte der Nachfolgestaaten freigestellt, doch ein Teil verzichtete freiwillig auf den Eid auf die Republik: Aristokraten waren im Bundesheer der Ersten Republik lange Zeit Mangelware.
Jedoch meldete sich mehr als die Hälfte der Offiziere wieder zum Dienst. An der Spitze der Hierarchie mussten 600 Generäle und 2.000 Obristen sofort pensioniert werden, weil in einem so stark geschrumpften Heer nicht mehr so viele Positionen zu vergeben waren. 1920 wurden dann alle Heeresangehörigen mit mehr als 30 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand geschickt. Österreich durfte maximal 1.500 Offiziere einstellen. Der christlichsoziale Unterstaatssekretär erwog, ob der Rest nicht vielleicht bereit wäre, als einfache Soldaten weiterzumachen. Ein Pilotprojekt in diesem Sinne waren die Grenzschutzpatrouillen, die gegen die ungarische Räterepublik aufgestellt wurden. Sie bestanden fast ausschließlich aus Offizieren. Doch die Sozialdemokraten legten sich von Anfang an quer. Sie befürchteten, die alten kaiserlichen Offiziere würden wegen ihrer Sympathien für die Monarchie eine Gefahr für die Republik darstellen. Otto Bauer schlug einmal sogar scherzhaft vor, man sollte die alten Offiziere zum Auswandern ermuntern und in den ehemaligen deutschen Kolonien ansiedeln. Natürlich gab es auch alte Offiziere im Lager der Sozialdemokraten, z. B. Generalmajor Theodor Körner, der spätere Bundespräsident, bis 1924 Sektionschef im Ministerium, oder Oberst Karl Schneller, der im Krieg das Italienreferat im Operationsbüro geleitet hatte, aber sie waren zweifellos in der Minderheit.
Sympathischer war den Sozialdemokraten die Idee, verdiente Unteroffiziere zu Offizieren zu befördern, was in der Monarchie fast ausgeschlossen gewesen war. Über Hundert dieser Volkswehrleutnante wurden 1919/20 ernannt, z. B. der Soldatenrat Josef Leopold, der es in der Volkswehr zum Hauptmann brachte (in der illegalen NSDAP dann zum Landesleiter). Vor allem aber plante Julius Deutsch, die Stellung der Soldatenräte - jetzt Vertrauensmänner genannt - im neuen Wehrgesetz zu verankern, um gegen alle „reaktionären Umtriebe“ des Offizierskorps gerüstet zu sein. Der gescheiterte „Kapp-Putsch“ in Berlin am 13. März 1920 verlieh diesen Befürchtungen sogar eine gewisse Aktualität. Das stellte eine Gratwanderung dar, wo bei den Kompetenzen der Soldatenräte die Sorge um das Wohl der Mannschaften und ihrer Interessen aufhörte und die Eingriffe in die Kommandogewalt der Vorgesetzten begannen. Offiziere waren ursprünglich nur auf vier Wochen bestellt worden und hatten sich dann einer Prüfung durch Kommissionen zu unterziehen, die sich zur Hälfte aus Soldatenräten zusammensetzten.
Angesichts des Tauziehens um den Einfluss im Bundesheer war es auch kein Zufall, dass die „Große Koalition“, die sich zur Zusammenarbeit entschlossen hatte, solange es um die Friedensverhandlungen und die Arbeit an der Verfassung ging, schon ein paar Monate vor diesem Ablaufdatum im Frühjahr 1920 auseinanderbrach. Der Anlass war ein Erlass von Julius Deutsch, der sich mit den Kompetenzen der Soldatenräte befasste, vom Kabinett aber nicht genehmigt worden war.
Ausblick
Das Wehrgesetz war noch im März 1920 beschlossen worden. Es blieb in dieser Form im Wesentlichen bis 1936 bestehen, als die Regierung Schuschnigg die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht beschloss, gegen die inzwischen auch die Westmächte nichts mehr einzuwenden hatten. Bis dahin blieb das Bundesheer ein „Heer im Schatten der Parteien“, wie der Professor für Zeitgeschichte, Ludwig Jedlicka, es formuliert hat. Die alljährlichen Vertrauensmännerwahlen ergaben ein ziemlich präzises Bild: Die ursprüngliche Dominanz des sozialdemokratischen „Militärverbandes“ blieb bis in die Mitte der zwanziger Jahre bestehen. Dann liefen die Verträge der 1919/20 angeworbenen Zeitsoldaten aus. Der langjährige christlichsoziale Heeresminister Carl Vaugoin begann mit der „Umpolitisierung“ des Bundesheeres. Ab 1927 hatte dann der bürgerliche „Wehrbund“ die Mehrheit, der anfangs noch überparteilich auftrat, schließlich aber den christlichsozialen Gewerkschaften beitrat.
Als Reaktion auf die „Umpolitisierung“ des Bundesheeres fasste die Sozialdemokratie 1923 die „Arbeiterwehren“ im „Republikanischen Schutzbund“ zusammen. Die bürgerlichen „Selbstschutzverbände“ - die teilweise noch aus der Zeit des Umbruches und der Grenzkämpfe übriggeblieben waren - sammelten sich unter diversen Bezeichnungen in den Heimwehren, die zunehmend an Eigendynamik gewannen: Sie erhielten ab 1928 Unterstützung von Mussolini aus Italien und traten 1930 schließlich als eigene Partei zu den Wahlen an. Diese Privatarmeen, mit ihren Manövern am Wochenende und provokanten Aufmärschen in Hochburgen des Gegners, waren ein Störfaktor für die Demokratie. In gewisser Weise waren sie aber wiederum ein stabilisierendes Element. Denn solange diese Formationen von alten Offizieren geführt wurden, kam es fast nie zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Erst wenn die geschlossenen Formationen sich auflösten und kleine Gruppen auf dem Heimweg aufeinander losgingen, waren immer wieder Gewalttaten zu verzeichnen.
Der Zulauf, den diese „Privatarmeen“ fanden, forderte immer wieder Kommentare heraus, dass mit einem Milizsystem diese Energien in eine konstruktive Richtung gelenkt werden könnten. Ganz im Unterschied zu den Beobachtungen der Umbruchszeit, dass die Leute vom Militär nichts mehr wissen wollten, konstatierte Bundeskanzler Ernst Streeruwitz, selbst alter Offizier, ein Dutzend Jahre später bereits ein „Doppelreihenhormon im Pubertätsalter“, das „in allen Klassen eine Art inoffizieller knieweicher Exerzierfreude“ hervorgerufen habe.
ao. Univ.-Prof. Dr. Lothar Alexander Höbelt; Lehrstuhl für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien.