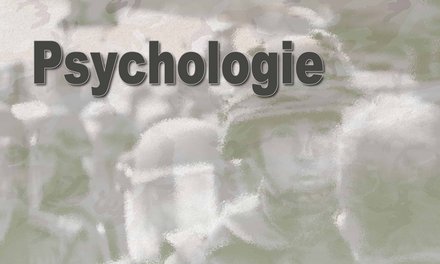Qualifikationsprofile

Bevor Bildungsangebote geschaffen oder bestehende Qualifikationen verglichen werden können, braucht es eine klare Definition der erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen – ein Qualifikationsprofil. Besonders im militärischen Bereich, etwa bei der Ausbildung von Berufsunteroffizieren, spielen solche Profile eine zentrale Rolle für die Entwicklung von Curricula und für die Anerkennung von Abschlüssen. Beispiele der Kaderanwärterausbildung zeigen, wie eine systematische Entwicklung von Qualifikationen zu einer effektiven und anerkannten Ausbildung führt.
Was ist ein Berufsunteroffizier? Welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz ergeben in Summe eine Maturantin an einer Allgemeinbildenden Höheren Schule? Wodurch unterscheidet sich die Qualifikation eines Installateurs in Österreich von einem Berufskollegen in Italien? Was soll mit einem konkreten Bildungsabschluss ermöglicht werden und was nicht? Solche oder ähnliche Fragen stellen sich, wenn etwa Bildungsangebote ins Leben gerufen oder bestehende Qualifikationen mit anderen verglichen werden sollen. Technisch gesprochen geht es dabei meist entweder um die Entwicklung von Curricula oder um Probleme der Anerkennung von Qualifikationen bzw. der Anrechnung von Prüfungen oder Abschlüssen einer Aus- oder Weiterbildung. In all diesen Fällen bilden Qualifikations- oder Anforderungsprofile – beide Begriffe sind synonym zu verstehen – eine unverzichtbare Grundlage. Ohne derartige Klarstellungen sind keine sinnvollen Antworten auf die erwähnten Fragen möglich.
Qualifikationsprofile im Bundesheer
Die Frage „Was ist ein Berufsunteroffizier?“ sollte von allen Ressortangehörigen des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) leicht beantwortet werden können. Bei näherer Betrachtung fällt auf: Wenn uns jemand fragt, wissen wir es, wenn wir es jedoch erklären sollen, sind wir unsicher. Je präziser die Definition sein soll, desto größer werden meist die Unklarheiten. Ausnahme: Es gibt ein seriös ausgearbeitetes Profil, das wir gut kennen oder an dessen Erstellung wir im Idealfall mitgewirkt haben. Letzteres ist deshalb ideal, weil bei derartigen Entwicklungen „der Teufel meist im Detail steckt“ und selbst um einzelne Begriffe lange und intensiv gerungen wird. Wer um dieses Ringen Bescheid weiß, kennt auch „die Ecken und Kanten“ einer konkreten Qualifikationsbeschreibung.
Im Bundesheer spielen Qualifikationsprofile in zweierlei Hinsicht eine besondere Rolle und zwar bei
- der Entwicklung von Curricula und
- vergleichenden Darstellungen von Qualifikationen, meist zum Zweck einer außermilitärischen Anerkennung, wie das für Berufs- und Milizunteroffiziere über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) bereits gelungen ist
Wie entsteht ein Qualifikationsprofil?
Die Ausführungen an dieser Stelle sind als Vorschlag zu verstehen. Sie decken sich mit den Grundlagen für eine Zuordnung zum NQR, damit bei künftigen Qualifikationsentwicklungen alle dafür erforderlichen Vorgaben von Beginn an eingehalten und mühsame Nachsteuerungen vor einer externen Anerkennung vermieden werden können. Zum Zweck der Anschaulichkeit wird hier die Entwicklung eines Anforderungsprofils anhand der Qualifikation „Kaderanwärter 1“ aus dem Jahr 2015 nachgezeichnet. Damit ist eine etablierte fünfmonatige Ausbildung am Beginn einer Laufbahn als Kadersoldat verbunden.
Territorialer Wachdienst
(Situation 1)
Akteure: Kaderanwärter 1, Offizier vom Tag, Wachkommandant, (un)bekannte Personen.
Handlung: Er leistet Wachdienst in Friedenszeiten und kann in standardisierten Szenarien situationsgerecht mit oder ohne Einsatz von Waffengewalt gegenüber anderen Personen im Sinne des erhaltenen Wachauftrages korrekt handeln.
Kenntnisse: Allgemeine Dienstvorschrift (ADV, Pflichten des Soldaten, Wachdienst, Waffengebrauch).
Fertigkeiten: Handhabung des Sturmgewehres; Kommunikation sowie Ruhe bewahren in unklaren und mitunter gefährlichen Situationen; Durchsetzungsvermögen; bewusst in eine Gefahr hinein handeln.
Kompetenz: Rasche Analyse komplexer sozialer Situationen mit mehreren Akteuren; geleitetes oder selbstständiges Handeln im Sinne eines Auftrages; Führen einer Waffe; Einfühlungsvermögen.
Entwicklungsschritte
Am Beginn dieses Beitrages werden die einzelnen Schritte kurz skizziert. Danach folgt eine ausführlichere Darstellung mit Beispielen. Es empfiehlt sich eine Herangehensweise vom Allgemeinen zum Besonderen, also mit dem „Big Picture“ bzw. der „Lage im Großen“ zu beginnen. In welchem Kontext bewegt sich die Qualifikation? Wie könnte der Qualifikationserwerb in das bestehende Bildungssystem eingeordnet werden? Welche Anforderungen sind vor Beginn der Qualifizierung, währenddessen oder erst nach Abschluss zu stellen?
Als Nächstes erfolgt die Beschreibung des Handlungsfeldes. Dabei wird das erstellte „Big Picture“ detailliert dargestellt. Kaum eine Qualifikation steht isoliert „im Raum“. Daher sind über- oder untergeordnete Elemente des Handlungsfeldes zu analysieren, sofern diese für das Gesamtverständnis erforderlich sind. In der darauffolgenden Präzisierung werden die Kernelemente des Handlungsfeldes identifiziert und in Form von Handlungssituationen ausgearbeitet. Welche Situationen oder Aufgaben sind in welchem Teilbereich des Handlungsfeldes zu bewältigen, damit von einem positiven Abschluss des Qualifikationserwerbes gesprochen werden kann?
Dieser Beurteilungsschritt weist auf Möglichkeiten der Gestaltung einer Abschlussprüfung hin und kann darauf basierende Überlegungen erleichtern – wenn er durchdacht umgesetzt wird. Am Ende können die Anforderungen an einen Qualifikationsträger aus den bereits geleisteten Bearbeitungsschritten abgeleitet werden. Damit liegt ein Qualifikationsprofil auf dem Tisch, das bei Bedarf, anhand genauerer Lernergebnisse und Rahmenbedingungen für Curricula oder etwa Zuordnungsersuchen im Kontext des NQR, ausgebaut werden kann.
Sicherungsdienst (Situation 2)
Akteure: Kaderanwärter 1, Gruppenkommandant, (un)bekannte Personen.
Handlung: Er leistet Sicherungsdienst in einem militärischen Einsatz, kennt die Unterschiede im Vergleich zum territorialen Wachdienst und kann in standardisierten Szenarien situationsgerecht mit oder ohne Einsatz von Waffengewalt gegenüber anderen Personen sowie mit oder ohne Einzelbefehl eines Kommandanten im Sinne des erhaltenen Auftrages korrekt handeln.
Kenntnisse: Allgemeiner Gefechtsdienst (AGD, Sicherung während der Ruhe und während des Marsches), Unterscheidung von Kombattanten und
Nicht-Kombattanten.
Fertigkeiten: Waffenhandhabung (Sturmgewehr, Maschinengewehr, Leuchtpistole); Kommunikation sowie Ruhe bewahren in unklaren und mitunter gefährlichen Situationen; Durchsetzungsvermögen; bewusst in eine Gefahr hinein handeln.
Kompetenz: Rasche Analyse komplexer sozialer Situationen mit mehreren Akteuren; geleitetes oder selbstständiges Handeln im Sinne eines Auftrages; Führen einer Waffe; Einfühlungsvermögen.
„Lage im Großen“
Dieser Punkt findet sich normalerweise nicht in Anleitungen zum vorliegenden Thema. Aufgrund von Erfahrungen des BMLV mit Zuordnungen militärischer Qualifikationen zum NQR ist dessen Beachtung jedoch dringend anzuraten. Die Art der Darstellung hat sich an der Zielgruppe zu orientieren. Soll etwa eine militärische Qualifikation transparent nach außen kommuniziert werden, muss deren Einbettung in das „Big Picture“ durch Nicht-Militärs verstanden werden. Auch wenn diese Aufbereitung nur systemintern relevant sein sollte, ist dennoch höchstmögliche Transparenz herzustellen, um Missverständnisse zu vermeiden und spätere Evaluierungen zu ermöglichen. Um eine solche Einbettung besser zu verstehen, kann eine weiterführende Qualifikation als Bezugspunkt gewählt werden – im vorliegenden Fall anhand des Berufsunteroffiziers für die Beschreibung eines „Kaderanwärters 1“ in Form einer Zwischenstufe.
Sollten sich in den einzelnen Schritten am Weg zum Qualifikationsprofil Änderungen ergeben, werden diese meist in den Folgeschritten zu Nachjustierungen führen. Mitunter ändert sich dadurch das Qualifikationsprofil und damit einhergehend die Hauptgrundlage für Durchführungsbestimmungen in der Ausbildung oder in Curricula. Evaluationen von Curricula sollten immer damit eingeleitet werden, zunächst das „Big Picture“ auf Richtigkeit und das Qualifikationsprofil auf Gültigkeit zu überprüfen. Das mag mühsam sein, ist aber als Qualitätskriterium unerlässlich.
„Lage im Großen“ – KAAusb1, Modell 2015
Als Kaderanwärter gelten alle Kandidaten für eine künftige Verwendung als Offizier oder Unteroffizier im Berufs- oder Milizstand. Die Ausbildung soll von allen Bewerbern für eine Kaderfunktion gemeinsam begonnen werden, wobei unterschiedliche Vorkenntnisse und Abholpunkte berücksichtigt und damit Anrechnungen und Quereinstiege ermöglicht werden. Ein Absolvent der KAAusb1 befindet sich am Ende der ersten Phase einer allgemeinen Qualifikation für eine Kaderfunktion. Die Entscheidung in Richtung einer Offiziers- oder Unteroffizierslaufbahn in einer Berufs- oder Milizverwendung sollte am Ende dieses Lehrganges vorliegen. Als Referenz für das beschriebene Handlungsfeld dient der Berufsunteroffizier in Erstfunktion mit Dienstgrad „Wachtmeister“, wenngleich dieses Ziel nur für Anwärter auf diesen Beruf erst nach abgeschlossener Kaderanwärterausbildung 3 erreicht wird und für Offiziersanwärter bzw. künftige Kadersoldaten der Miliz zu adaptieren ist.
Beschreibung Handlungsfeld
Das Handlungsfeld legt jenen Bereich fest, innerhalb dessen sich eine qualifizierte Person bewegt. Es ist darzustellen, in welchen Funktionen oder Verantwortungsbereichen am Ende der Qualifizierung, in welchem Komplexitätsgrad und mit welchem Ausmaß an Selbstständigkeit oder Eigenverantwortung möglichst konkret definierte Tätigkeiten verrichtet werden können. Bezeichnungen (Deskriptoren) des NQR bieten für die Definition des Zielniveaus einen guten Anhalt und sollten genutzt werden, wenn eine Zuordnung der Qualifikation zum NQR in Erwägung gezogen wird oder eine solche nicht ausgeschlossen scheint. Klare Aussagen zu Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenz bilden eine Grundlage für abzuleitende Lernergebnisse. Sollte eine zu entwickelnde Qualifikation noch kein geschlossenes Bild ergeben, wie am Beispiel der KAAusb1, empfiehlt sich eine Ableitung von einer Referenzqualifikation, wie etwa dem „Berufsunteroffizier“, der die gesamte Kaderanwärterausbildung bis zur Ebene 3 absolviert.
Führung einer Gruppe im gesicherten Fußmarsch (Situation 3)
Akteure: Kaderanwärter 1, eigene Gruppe, Feinddarstellung.
Handlung: Er führt unter Belastung eine Gruppe am Tag im gesicherten Fußmarsch in einer Normstation, kann auf einen in der Gefechtsbereitschaft überlegenen Feind treffend je nach Lage mit einem standardisierten Verfahren reagieren und meldet Ansatzmöglichkeiten für den Zug als übergeordnete Ebene.
Kenntnisse: AGD, Waffenvorschriften StG77, P80, MG74, Leuchtpistole 57, Handgranate (HGr); Gefechtsbild/Bedrohungsbild, Führungsverfahren und Detailbefehl.
Fertigkeiten: Durchführung einer Befehlsausgabe, Waffenhandhabung, Tarnen und Täuschen, Geländeausnützung, Beobachten und Melden, Feuerkampf führen, Verbindung nach oben und in der Gruppe halten, Orientieren im Gelände, Einsatz Kampfmittel (Nebel, HGr), Einsatz Leuchtmittel.
Kompetenz: Rasche Analyse komplexer Situationen mit mehreren Akteuren; geleitetes oder selbstständiges Handeln im Sinne eines Auftrages; Führen einer Waffe; Führen und Einsatz der Gruppe; Handeln im Sinne der übergeordneten Führungsebene (Zug).
Handlungsfelder
In weiterer Folge werden die Handlungsfelder der KAAusb1, 2 und 3 am Modell 2015 in absteigender Hierarchie vorgestellt.
Berufsunteroffizier
Der Berufsunteroffizier (Referenzqualifikation, Abschluss KAAusb3) in Erstfunktion ist Kommandant einer Gruppe von Soldaten. In dieser Funktion ist er in der Regel verantwortlich für die allgemein-militärische oder waffengattungsspezifische Führung, Ausbildung und militärische Erziehung von acht bis zwölf Personen mit Mannschaftsdienstgraden (Rekruten oder Chargen). Er ist zudem Spezialist mit Bezug auf die Erstfunktion in der eigenen Waffengattung oder im eigenen Fachgebiet. Dieser Punkt wird in den spezifischen Handlungsfeldern in Bezug auf die KAAusb2 näher erläutert.
Trotz ihres jungen Alters sind die frisch ausgebildeten Berufsunteroffiziere in der Ausbildung und vor allem im Einsatz bereits in ihrer Erstverwendung – insbesondere im Umgang mit Wehrpflichtigen – in einem höchst sensiblen und verantwortungsvollen Bereich der Menschenführung tätig. Sie sind als ausgebildete Führungskräfte und soldatische sowie menschliche Vorbilder für zu führende und auszubildende Personen in der Lage, situationsangemessen Entscheidungen zu treffen und unter Einsatz der zur Verfügung gestellten Ressourcen Aufträge zu erfüllen.
Dabei ist es notwendig, militärische, rechtliche, politische, ökonomische oder ethisch-moralische Bedingungen zielorientiert und unter Hintanstellung eigener Bedürfnisse – auch unter großer psychischer und physischer Belastung – bei Einsätzen im In- und Ausland zu berücksichtigen. Diese Qualifikation entspricht nach dem Nationalen Qualifikationsrahmen sogar einer vollinhaltlich abgeschlossenen Berufsausbildung mit einem weit überdurchschnittlichen Fokus auf eine Führungstätigkeit auf unterster Ebene. Daher ist die Qualifikation zum Berufsunteroffizier seit Dezember 2018 auf dem hohen NQR-Niveau 4 eingestuft.
Kaderanwärter 2
Der Kaderanwärter 2 (Zwischenstufe zur Referenzqualifikation) ist für waffengattungsspezifische und einsatzbezogene Führungsaufgaben auf der Ebene Gruppe qualifiziert, sofern nicht Sonderregelungen anderes zum Ausdruck bringen. Die Einstiegsvoraussetzungen für weiterführende Ausbildungen zum Offizier oder Unteroffizier sind erfüllt. Der Kaderanwärter 2 verfügt über eine ausgeprägte Selbst- und Fremdeinschätzungsfähigkeit im Kontext des Lernens sowie eine bereits gereifte Aneignungskompetenz in Bezug auf individuelle Lernziele. Er tritt als ausgebildete Führungskraft, sich der eigenen Rechte und Pflichten bewusst, in der militärischen und zivilen Öffentlichkeit den Vorschriften konform und als Werbeträger für künftige Kadersoldaten, insbesondere der eigenen Waffengattung, auf.
Kaderanwärter 1
Der Kaderanwärter 1 befindet sich am Weg zur Erstverwendung auf einer Zwischenstufe, deren Erreichung die Verwendung als Soldat im Normdienstbetrieb sowie für Inlandseinsatzaufgaben ohne fachliche bzw. waffengattungsspezifische Voraussetzungen ermöglicht. Es können auf Basis der dafür erforderlichen physischen und psychischen Leistungsfähigkeit einfache Führungsaufgaben auf Truppebene – das heißt für ein Team von etwa vier Personen – in Bereichen der Sicherung, des Marsches und der Bewachung als Verfahren zur Sicherstellung des Gefechtes gestellt werden. Die Einstiegsvoraussetzungen für die Fachausbildung in Bezug auf die Erstverwendung im Rahmen der Kaderanwärterausbildung 2 sind erfüllt.
Der Kaderanwärter 1 verfügt bereits über eine gereifte Selbst- und eine sich kontinuierlich entwickelnde Fremdeinschätzungsfähigkeit im Kontext des Lernens sowie eine der Handlungsebene entsprechende Aneignungskompetenz in Bezug auf individuelle Lernziele. Er tritt als kompetenter Soldat und angehende Führungskraft, sich der eigenen Rechte und Pflichten bewusst, in der militärischen und zivilen Öffentlichkeit den Vorschriften konform und als Werbeträger für künftige Kadersoldaten auf. Eine Zuordnung zum NQR erscheint auf dieser Zwischenebene noch nicht zielführend.
Truppgefechtsschießen
(Situation 4)
Akteure: Bis zu vier Kaderanwärter; Funktions- und Leitungspersonal.
Handlung: Er führt nach Abschluss eines Führungsverfahrens mit anschließender Befehlsgebung, unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, einen Trupp im scharfen Schuss.
Kenntnisse: Vorschriften StG77, AGD, Sicherheitsbestimmungen; Kenntnis der Übungsplatzordnung, Führungsverfahren, Befehlsgebung, Führungsgrundsätze.
Fertigkeiten: Waffenhandhabung StG77, Kommunikation sowie Ruhe bewahren in unklaren und mitunter gefährlichen Situationen; Durchsetzungsvermögen, schießtechnische Voraussetzungen gemäß den gültigen Bestimmungen.
Kompetenz: Führen des Trupps; rasche Analyse komplexer wechselnder Situationen; selbstständiges Handeln im Sinne eines Auftrages.
Handlungssituationen
An dieser Stelle müssen die wichtigsten Szenarien überlegt werden, die nach Erwerb der Qualifikation zu bewältigen sind. Dazu sollten zunächst aus dem Handlungsfeld jene Themenfelder oder Inhalte herausgefiltert werden, welche die Qualifikation besonders charakterisieren. Diese Themen können später in einem Curriculum zu Bezeichnungen für Module oder Lehrveranstaltungen werden. Zu Beginn werden die Akteure festgelegt, die für die Gestaltung einer Situation benötigt werden. Danach folgt das Kernelement eines Szenarios: die Beschreibung der Handlung selbst. Dabei ist der höchste anzustrebende Schwierigkeitsgrad in Form eines Lernergebnisses zu definieren. Schlussendlich ist vor allem im Kontext des NQR das Lernergebnis noch in Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz zu gliedern.
Bei der Entwicklung der Qualifikation „Kaderanwärter 1“ wurden 2015 zunächst folgende Themenbereiche für Handlungssituationen vorgeschlagen: Territorialer Wachdienst, Sicherungsdienst, Führung einer Gruppe im gesicherten Fußmarsch, Truppgefechtsschießen, Diskussion zum Thema Soldatenberuf sowie Reflexionsgespräch über das eigene Führungs- und Lernverhalten. Eine Aufgliederung in die Unterpunkte der Situationsbeschreibung wurde zum damaligen Zeitpunkt, wie in den Kästen beschrieben, in Betracht gezogen.
Diskussion zum Thema Soldatenberuf (Situation 5)
Akteure: Maximal zehn Kaderanwärter, geschultes Personal (Kompanie- oder Zugskommandant).
Handlung: Er ist sich als österreichischer Staatsbürger in militärischer Uniform der besonderen Verantwortung seiner Tätigkeit im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols inklusive der für die Chargenebene abgeleiteten Rechte und Pflichten bewusst und kann diese auch in der Öffentlichkeit argumentieren.
Kenntnisse: Grundlagen Politische Bildung (WPol – Soldat und Gesellschaft); Grundlagen Heereskunde (Soldat und eigener Verband); ADV (Rechte und Pflichten des Soldaten); Grundlagen des Militärbefugnisgesetzes (MBG), Verhaltensregeln.
Fertigkeiten: Selbst- und Fremdbeobachtung; Konstruktive Gesprächsführung mit Bezug zum Soldat-Sein in einem demokratischen Rechtsstaat.
Kompetenz: Mündliche Ausdrucksfähigkeit in Gesprächssituationen in deutscher Sprache, situative Gesprächsführung, aktive Gesprächsteilnahme.
Qualifikationsprofil
Am Ende muss eine Verdichtung aller bisherigen Zwischenergebnisse erfolgen, damit ein kompaktes und aussagekräftiges Anforderungsprofil vorgelegt werden kann. Wichtige Aussagen, die nicht direkt ins Profil passen, können als Erläuterung und Ergänzung dienen. Ein Qualifikationsprofil für einen „Kaderanwärter 1“ als Resultat obiger Überlegungen könnte wie folgt aussehen, wenn die wichtigsten Anforderungen auf
- Soldat-Sein,
- Führung,
- Einstiegsvoraussetzungen für weiterführende Qualifikationen,
- Urteilsfähigkeit und
- Wirkung der Qualifikation nach außen heruntergebrochen werden:
Der Absolvent der Kaderanwärterausbildung 1 kann folgende Anforderungen erfüllen:
- Als Soldat ohne Führungsfunktion ist er für waffengattungsunabhängige Einsatzaufgaben einer Charge im Inland sowie für den Normdienstbetrieb inklusive einfacher Unterstützungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung innerhalb einer österreichischen, militärischen Einheit oder Liegenschaft ohne Einschränkungen verwendungsfähig.
- Als Kommandant eines Trupps kann er die wesentlichen Waffen ebenenbezogen führen sowie Kampfmittel einsetzen und waffengattungsunabhängige Aufträge mit Bezug auf Inlandseinsätze unter enger Anleitung eines Vorgesetzten erfüllen.
- Als Anwärter für den Offiziers- oder Unteroffiziersberuf bzw. einer entsprechenden Milizfunktion verfügt er über alle Voraussetzungen zum Einstieg in die waffengattungsspezifische Ausbildung gemäß den dafür gültigen Kriterien.
- Als Teilnehmer einer laufenden Kaderanwärterausbildung ist er nach der KAAusb1 bereits in der Lage, sich selbst und zum Teil auch seine Kameraden hinsichtlich persönlicher Stärken und Schwächen mit Bezug auf soldatische Führungsherausforderungen sowie hinsichtlich der Rolle eines Auszubildenden, inklusive aktueller Grenzen und Verbesserungsmöglichkeiten, einzuschätzen.
- Als österreichischer Staatsbürger in militärischer Uniform ist er sich der besonderen Verantwortung seiner Tätigkeit im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols, inklusive der für die Chargenebene abgeleiteten Rechte und Pflichten, bewusst und kann diese auch in der Öffentlichkeit argumentieren.
Obige Definitionen, etwa zu waffengattungsunabhängigen Aufgaben oder wesentlichen Waffen sowie Kampfmitteln, richten sich nach den jeweils aktuellen Vorschriften und zielen auf das Referenzmodell der Jägertruppe ab. Das für das Bundesheer geltende militärische Berufsethos sowie die Grundsätze einer zeitgemäßen, gender- und diversitygerechten, frauenförderlichen sowie menschenorientierten Führung und Bildung, inklusive Ausbildung, werden als Unterrichtsthemen im Wesentlichen erst bei späteren Lehrgängen angeboten. Jedoch werden sie bei der Kaderanwärterausbildung 1 mit besonderer Aufmerksamkeit bei der Dienstaufsicht, durch das Verhalten des Führungs- und Lehrpersonals, informell erlebt und damit erlernt.
Gespräch über das Führungs- und Lernverhalten (Situation 6)
Akteure: Kaderanwärter 1, Vorgesetzte bzw. Ausbildungspersonal (pädagogische Expertise, Führungsexpertise Zugskommandant aufwärts oder Trainer Führung).
Handlung: Er reflektiert im Dialog mit Vorgesetzten bzw. einschlägigem Fachpersonal für Führung und Pädagogik das eigene Verhalten in Führungs- und Lernsituationen anhand ständiger Beobachtungen und Aufzeichnungen am Modell des Lerntagebuches in der Ausbilderfibel des Bundesheeres und erhöht damit laufend die Kompetenz der Aneignung von Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Dabei sollen allgemeine Grundsätze der Führung und des Lernens mit individuellen Besonderheiten unter Hervorhebung und Förderung der jeweiligen Stärken gegenübergestellt werden.
Kenntnisse: Grundlagen der militärischen Führung auf unterster Ebene; Lerntechniken; Grundsätze des kognitiven, affektiven und psychomotorischen Lernens; Umgang mit Lernunterlagen und sonstigen Quellen; Unterschied Selbst- und Fremdbild.
Fertigkeiten: Selbst- und Fremdbeobachtung; Konstruktive Gesprächsführung mit Bezug zur eigenen Person; Führung von Aufzeichnungen am Beispiel eines Lerntagebuches; Aufbereitung und Bearbeitung von individuellen Lernfeldern, mündliche Ausdrucksfähigkeit in Gesprächssituationen in deutscher Sprache.
Kompetenz: Kritikfähigkeit; Medienkompetenz inklusive der Berücksichtigung militärisch-sicherheitsrelevanter Aspekte.
Zusammenfassung
Ein professionell entwickeltes Qualifikationsprofil ist ein wesentliches Fundament für ein qualitativ hochwertiges Curriculum und spätere Evaluationen. Spätestens bei der Darstellung von Befähigungen nach außen, beispielsweise im Zuge der gewünschten Zuordnung einer Qualifikation zum Nationalen Qualifikationsrahmen, wird ein solches Profil dringend benötigt.
Oberst dhmfD Mag. Andreas Kastberger;
Hauptlehroffizier und Referatsleiter allgemeine Grundlagen und Ausbildungsunterstützung an der Heeresunteroffiziersakademie, Leiter des Wirkungsfeldes „Methodik und Didaktik“ im Wirkungsverbund Militärhochschule.

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).