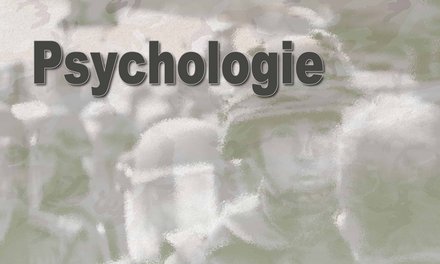Kradmelder

Der Kraftradmelder – kurz Kradmelder – ist der Nachfolger des Melders zu Fuß und zu Pferd. Der Fortschritt der Fernmelde- und IKT-Technologie ließ diese Art der Datenübermittlung in den vergangenen Jahrzehnten beinahe obsolet erscheinen. Mit der Verbreitung gegnerischer Stör- und Peilmaßnahmen gewinnt der Kradmelder wieder an Bedeutung.
Einsatzumfeld
Das Gefechtsfeld des 21. Jahrhunderts ist u. a. von hohen Aufklärungskapazitäten aus der Luft und dem Weltall gemeinsam mit der Elektronischen Kampfführung (EloKa) geprägt. Die Wahrnehmung und Aufklärung von einzelnen, physischen Gefechtsteilnehmern ist inzwischen wesentlich geringer als die Zuordnung von Signalen durch EloKa-Kräfte. Das Ab- und Mithören feindlicher Akteure sowie die Störung von Funk- und IKT-Mitteln rückt in den Vordergrund. Aktuelle und historische Gefechtsbeispiele zeigen, dass bei Verbindungsmitteln ohne physische Authentifizierung – dem Gespräch von Angesicht zu Angesicht – fast immer die Gefahr eines Täuschmanövers besteht.
Ein Beispiel dafür sind erbeutete Funkgeräte, weil sie im entscheidenden Moment zur Verbreitung von falschen Befehlen und Lagemeldungen durch feindliche Kräfte eingesetzt werden können. Auch die Aufnahme des Funksprechverkehres vom vorangegangenen Kampftag und die Wiedergabe am nachfolgenden Tag, um den Gegner zu verwirren, sind beobachtbar. Das Perfide dabei ist, dass es sich beim Funk um vertraute Stimmen handelt und damit eine Täuschung länger aufrechterhalten wird. Die Zusammenarbeit mit neuen Technologien, wie dem Einsatz von KI-unterstützten Ton- und Sprachaufnahmen, die täuschend echt klingen, oder zusammengeschnittene Satzfragmente, erschweren es, Truppen zu führen. Um genau diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, wird auf altbewährte Mittel zurückgegriffen. Eines davon ist der Kradmelder.
Stärken des Kradmeldertrupps
Kradmelder bestechen durch ihre
- hohe Mobilität,
- vergleichsweise geringe Wahrnehmbarkeit im elektromagnetischen Umfeld und ihren geringeren „Fußabdruck“ für Bodenüberwachungsradare,
- hohe Geländegängigkeit,
- schwierige optische Aufklärbarkeit und ihre
- Flexibilität im Aufgabenspektrum.
Fälschungssicherheit
Meldungen per Krad abzufangen und zu fälschen ist weitaus aufwendiger als über Funk. Ebenfalls ist eine Überprüfung der Authentizität „face to face“ viel einfacher durchzuführen. Für das Gegenüber ist das Einschleusen von „Scheinkradmeldern“ hinter den feindlichen Linien mit unverhältnismäßig hohem Aufwand und Risiko verbunden. Denn dafür wären sowohl ein unerkanntes Einsickern durch die Frontlinien als auch der Einsatz von adäquaten Uniformteilen, Ausweisen, Sprachkenntnissen sowie Fahrzeugen notwendig. Um den Informationsverlust bei Gefangennahme des Kradmelders zu verhindern bzw. zu erschweren, müssen in stark feindgefährdeten Bereichen Verschlüsselungsmaßnahmen eingesetzt und Vorbereitungen getroffen werden, die ein rasches Vernichten von Meldungen ermöglichen. Erst dann kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass die Informationen nur in die Hände der gewünschten Gegenstelle gelangen und der Kradmelder als zuverlässiges, direktes Kommunikationsmittel angesehen wird.
Drohnenbedrohung
Im Vergleich zum Kampf gegen Drohnen, die eine immer größere Wirkung entfalten, hat der Kradmelder deutliche Vorteile. Durch seine hohe Mobilität und Geschwindigkeit auf und abseits von Straßen und Wegen sowie die schwierigere Aufklärbarkeit im Vergleich zu größeren Fahrzeugen, ist er durch sein Fahrverhalten vor der Zielauffassung durch Drohnen geschützt. First-Person-View-Drohnen sind oftmals nicht wendig genug, um ein hakenschlagendes Krad in voller Fahrt im Wald zu bekämpfen. Der Einsatz von mehreren Drohnenwirkmitteln und Steilfeuer gegen einen Kradtrupp wird somit zu einer Ressourcenfrage.
Einsatzräume
Kradmelder sind in allen Einsatzarten und -räumen zu finden. In unübersichtlichem Umfeld wie in urbanen Räumen und gegen asymmetrische Feinde überzeugt der Kradeinsatz durch die hohe Wendigkeit und Geschwindigkeit. Gegen einen konventionellen und gar überlegenen Feind wird er selbst zum Mittel der asymmetrischen Kriegsführung, kann die feindliche Funkaufklärung unterlaufen und nadelstichartige Angriffe durchführen.
Kapazität
Die Bewaffnung der Kradmelder richtet sich nach dem Aufgabenspektrum, wird zumeist aber aus Waffen mit kleinem Packmaß bestehen. Maschinenpistolen oder Sturmgewehre mit verkürzter Länge in Verbindung mit regulären Pistolen als Zweitbewaffnung sind der Grundstock der Selbstverteidigung des Kradmelders. Die Mitnahme von Drohnen, Funkmitteln und Schriftstücken inklusive Kartenmaterial, Plänen der Durchführung und Kuriertätigkeiten schränken die Transportkapazität des Kradmelders ein. Der Einsatz von Panzerabwehrwaffen durch den Kradmelder ist möglich, jedoch nur mit stark limitiertem Munitionsvorrat. Ein weiterer Einsatz von schweren Waffen oder Sonderwaffen ist wegen der geringen Transportkapazität nicht zielführend.
Einsatzgrundsätze
Dem Grundsatz „Einer ist keiner“ folgend, findet der Haupteinsatz des Kradmelders im Trupp mit zwei Soldaten auf zwei Motorrädern statt. Dies ergibt sich aus der Notwendigkeit, die klassischen Fahrweisen wie geschlossene, überschlagende oder raupenartige Bewegung anwenden zu können.
Feuer und Bewegung
Der Einsatz zu zweit ermöglicht Feuer und Bewegung innerhalb des Kradtrupps. Die Fahrt zu zweit verdoppelt die Wahrscheinlichkeit, dass zu überbringende Nachrichten im Falle eines Unfalles, Feindkontaktes oder sonstiger Gefahren auf dem Marschweg dennoch ihr Ziel erreichen. Die Verbindung zwischen den beiden Kradmeldern kann durch Funkgeräte geringer Reichweite und Abstrahlung oder durch Hand- und Flaggenzeichen erfolgen. Das entspricht dem Vorgehen von motorisierten Marschspitzen, Nahsicherungskräften und Aufklärern.
Redundanz
Der Grundsatz zur „redundanten Überlagerung mit anderen Verbindungsmitteln“ gilt auch für Kradmelder. Der Einsatzradius der Kradmelder ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit (Fahrbahn) und der Feindbedrohung. Mit steigender Entfernung erhöht sich der Zeitbedarf für die Nachrichtenübermittlung. Der Ausgangspunkt jeder Kradmeldernachricht ist entweder eine (Daten-)Funkstelle oder ein Gefechtsstand. Der Einsatz des Krads ist zweckmäßig, wenn die Bedrohung im elektromagnetischen Umfeld als „hoch“ eingestuft und die Dringlichkeit auf der Zeitachse als „gering“ bewertet ist. Sollte eine Lageänderung einen sofortigen Übermittlungsbedarf erforderlich machen, muss gefunkt werden. Funk, kabelgestützte Kommunikation und Krad existieren somit nebeneinander und unterscheiden sich in der Dringlichkeit der Meldung und der Feindbedrohung physisch sowie im elektromagnetischen Feld.
Zyklischer Einsatz
Im Bereich der Nachrichtenüberbringung sollte eine zyklische Verbindungsaufnahme eingehalten werden. Dies ist als Sicherheit und Zustandsbericht für den Sender und Empfänger einer Nachricht zu verstehen. Der Sender, das vorgesetzte Kommando, kann so durch den Kradmelder stellvertretend den Zustand der Truppe und des Verantwortungsbereiches überprüfen und zugleich periodische, wiederkehrende Meldungen außerhalb des elektromagnetischen Spektrums erhalten. Standes- und Bedarfsmeldungen werden gleich abgefragt und haben den positiven moralisch-psychologischen Effekt, dass sich die Truppe nicht alleingelassen fühlt. Der Faktor Mensch und die physische Kontaktaufnahme durch Vertreter des vorgesetzten Kommandos wirken sich hierbei positiv aus. Durch einen solchen Zyklus kann das „Verschwinden“ von Kradmeldern erkannt und dementsprechend reagiert werden.
Wie Wasser
Zur Geländeausnützung und der Wahl des Marschweges wendet der Kradtrupp den Panzertruppen-Grundsatz „Fahren, wie das Wasser fließt“ an. Damit ist gemeint, dass Höhen und übersichtliches, weitgehend ebenes Gelände vermieden werden, vergleichbar mit Wasserläufen, die immer durch tiefe Lagen fließen. Markante Geländeerhebungen eignen sich zwar für eine weitreichende Beobachtung, ziehen jedoch ebenso feindliches Flach- und Steilfeuer an. Durch die Geländeausnützung von unübersichtlichem, welligen und bedeckten Gelände kann sich der Kradmelder der Boden- und Luftsicht entziehen und die Flachfeuerwirkung meist auf eine Geländekammer minimieren.
Der Kradmeldertrupp folgt aufgrund seines geringen Kampfwertes den Grundsätzen der Aufklärer und handelt nach dem Grundsatz „Viel sehen und nicht gesehen werden“. Stets sind immer Geschwindigkeit und Sicherheit gegeneinander abzuwägen, wobei der Fokus auf der Zustellbarkeit der mitgeführten Nachrichten liegt. Hinter den eigenen Linien können Kradmelder mit erhöhter Geschwindigkeit und zugleich geringerer Beobachtungsfähigkeit fahren. Je höher die Feindbedrohung und je schwieriger die Geländebedingungen, desto langsamer bewegen sie sich und nützen das Gelände intensiver, teils abgesessen, aus.
Eigenschutz
Der Kradmelder vermeidet den direkten Kampf. Durch seine hohe Mobilität bietet er sich jedoch an, Flanken zu überwachen oder einen feindlichen Ansatz in schwierigem Terrain zu erkennen. In Verbindung mit gefechtstechnischen Drohnen, die der Kradtrupp selbst mitführen kann und weitreichenden Funkmitteln ist es möglich, mit geringer Personalstärke und kleinem Aufwand einen verhältnismäßig großen Geländeabschnitt zu überwachen.
Grundsätze
- Einer ist keiner (truppweiser Einsatz).
- Redundante Überlagerung mit anderen Verbindungsmitteln an
- entscheidenden Knotenpunkten: Funk, Kabel, Krad, Melder.
- Zyklische Verbindungsaufnahme zur Nachrichtensicherheit.
- Fahren, wie das Wasser fließt.
- Viel sehen, nicht gesehen werden.
- Überwachung von Flanken.
Einsatzmöglichkeiten
Die Hauptaufgaben des Kradmeldertrupps lassen sich in
- Aufklärer,
- Melder,
- Sicherung auf dem Marsch und
- in die Nebenaufgabe Panzerabwehrtrupp unterteilen.
Der Einsatz als Panzerabwehrtrupp kommt einer Zweitrollenfähigkeit gleich und sollte die Ausnahme sein. Das gilt grundsätzlich für die Normtruppe. Dass Ausnahmen die Regel bestätigen, zeigte sich in den frühen Gefechten des russisch-ukrainischen Konfliktes: Dabei kamen mobile Panzervernichtungstrupps auf Motorrädern und Quads zum Einsatz, die nachstoßende russische Elemente störten.
Einsatz als Aufklärer
Für die Aufklärung eignet sich der Kradmelder durch seine geringe Wahrnehmbarkeit und hohe Geschwindigkeit. In Verbindung mit der Möglichkeit des raschen Wechsels der Kampfweise vom auf- zum abgesessenen Vorgehen sowie dem beinahe uneingeschränkten Vorankommen in schwierigem Gelände steht das Krad als Aufklärungsmittel nur dem Einsatz von Drohnen nach. Drohnen und Kradfahrer klären manchmal dasselbe Ziel auf, wenn auch in anderen Domänen und mit einem entscheidenden Unterschied: Ein Kradaufklärer ist nur durch kinetische Mittel zu stoppen.
Geländefahrt
Um sich der feindlichen Aufklärung aus der Luft und vom Boden zu entziehen, bewegt sich der Kradmelder in einer Kombination aus auf- und abgesessenem Einsatz und umfährt grundsätzlich Gefahrenstellen wie offene Flächen. Um eine Staubentwicklung und Spuren zu vermeiden, fährt der Trupp in Wäldern oder auf befestigten Straßen. Die Art des Motorrades spielt eine entscheidende Rolle. Elektromotorräder weisen eine geringere akustische Wahrnehmbarkeit auf. Sie haben derzeit jedoch noch keine logistisch geplante und sichergestellte Energieversorgung. Verbrenner sind lauter, verfügen aber über eine höhere Reichweite und vereinfachen die Versorgung, weil ihr Betrieb in der Regel denselben Treibstoff benötigt, der auch in anderen Teilen der Streitkräfte Verwendung findet. Die Mitnahme von Zusatztreibstoff bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren erfordert kaum zusätzlichen logistischen Aufwand.
Tieferes Verständnis
Im Aufklärungseinsatz muss der Kradmelder Lücken in der feindlichen Einsatzführung erkennen, die Gangbarkeit für nachfolgende schwerere Kampffahrzeuge bewerten und die Tragfähigkeit von Brücken, Straßen und dem Untergrund beurteilen können. Hierfür braucht der Kradmelder eine gediegene Ausbildung und ein tieferes Verständnis für große Truppenkörper und die damit verbundenen Anforderungen im Gelände.
Limit Kampfkraft
Eines ist der Kradmelder meistens nicht: kampfkräftig. Angesichts dieser Tatsache sowie der eingeschränkten Durchhaltefähigkeit und der geringen Transportkapazität befindet er sich meist nicht weit vor den eigenen Kräften. Er agiert zeitlich nahe an den Hauptkräften. Um die Wahrscheinlichkeit eines direkten Auftreffens auf feindliche Kräfte zu minimieren, wird er nicht im Gelände der kampfkräftigen Gefechtsaufklärung eingesetzt, sondern versucht, Umgehungsmöglichkeiten und Alternativstoßachsen aufzuklären.
Einsatz als Melder
Die Königsklasse und Hauptaufgabe des Kradmelders ist der Melde- und Kurierdienst. Als Hauptmittel der schnellen, signaturarmen und verlässlichen Verbindung in unwegsamem Gelände benötigt er ein hohes Maß an Orientierungssinn und Geländebeurteilung. Das Überbringen von Meldungen kann entweder direkt an die Empfänger oder indirekt über Tote Briefkästen erfolgen und umfasst kleine Versorgungsgüter, schriftliche und grafische Befehle sowie das Entgegennehmen von Meldungen für andere Kommanden. Rucksäcke und Gepäcktaschen erhöhen den Transportraum des Kradmelders. Hierbei muss jedoch auf die Möglichkeit zum raschen Unbrauchbarmachen der Informationen geachtet werden, weil oft Gefangennahme oder Vernichtung drohen.
Bei Einsatzarten mit längerer Verweildauer, wie Schutz und Verteidigung sowie in Bereitstellungs- und Verfügungsräumen, sind Kradmelder ein wesentlicher Bestandteil, um eingesetzte Truppen zu überprüfen. Durch die fehlende Funksignatur unterstützen sie die Verschleierung von Truppenbewegungen und -aufenthalten. Dadurch tragen sie zur Tarnung im elektromagnetischen Umfeld bei. Bei dynamischen Gefechtsaufgaben mit raschen Positionsänderungen, wie im Angriff und in der Verzögerung, können sie durch ihre überlegene Geschwindigkeit sowohl mit den Angriffsspitzen mithalten als auch zwischen den einzelnen Elementen zeitgerecht Nachrichten überbringen. Als Kampfkraftsteigerung und zur Abwehr von feindlichen Maßnahmen der Elektronischen Kampfführung können Kradmelder zum behelfsmäßigen Feldkabeltiefbau eingesetzt werden. Damit ermöglichen sie eine sichere Verbindung. Die Hauptaufgabe des Kradmelders ist es, Informationen verlässlich und zeitgerecht in die richtigen Hände zu übergeben und damit die Informationsüberlegenheit als Basis von Handlungsfreiheit zu erhalten.
Einsatz zur Marschsicherung
Die Brücke zwischen dem Einsatz als Aufklärer und als Melder schlägt der Einsatz während eines Marsches. Hierbei kann der Kradmelder vorgestaffelt Kreuzungen und lokale Drehscheiben sichern, die Gangbarkeit von Marschwegen und Umfahrungsmöglichkeiten erkunden sowie den Verkehr regeln, um das zügige Vorankommen des eigenen Marschpaketes zu gewährleisten. Die Sicherung und Bedeckung von Nachschub- und Versorgungskolonnen bei geringer Feindbedrohung fällt ebenfalls in das Aufgabenspektrum von Kradmeldern. Bei diesem Einsatz besticht er besonders durch die hohe Kostenökonomie und den geringen Eingriff in den restlichen Verkehr. Durch die Wendigkeit und hohe Geschwindigkeit im Straßenverkehr kann der Kradmeldertrupp vorauseilen, Geländeteile sichern, nachjagen und beispielsweise nach einer Verkehrsregelung die Spitze durch einfache Überholmanöver wieder einnehmen.
Einsatz als Panzerabwehrtrupp
Durch die hohe Mobilität, Geschwindigkeit und geringe Silhouette des Kradtrupps ergibt sich seine natürliche Zweitrollenfähigkeit auch im Einsatz als Panzervernichtungstrupp. Die schnelle Verbringung durch unwegsames Gelände und der rasche Stellungswechsel zwingen feindliche motorisierte und mechanisierte Kräfte zu entwickeln, die Lage zu beurteilen und damit sich zu verlangsamen. Unabhängig davon, ob Kradmelder vom Motorrad oder abgesessen feuern, sollte ihr Einsatz in der Flanke oder in den Rücken des Feindes erfolgen. Von einer Duellfähigkeit kann keinesfalls gesprochen werden und auch die Nachhaltigkeit dieser Einsatzaufgabe ist gering, wodurch sie eher in den Bereich der Verzögerung sowie des Jagdkampfes oder der asymmetrischen Kriegsführung fällt. Des Weiteren wird der Einsatz auch durch die sehr reduzierte Munitionsmenge am Motorrad eingeschränkt. Um die Schussvorbereitungszeit zu senken und die Verweildauer an der Abschussstelle zu verringern, empfiehlt es sich Einweg-Panzerabwehrwaffen zu verwenden.
Geburt einer neuen Kradmelder-Generation
Am Institut für Kraftfahrwesen der Heereslogistikschule in Zwölfaxing startet das Training zukünftiger Kradfahr(schul)-Lehrer. Ausbildungsleiter Major Michael Koller (Bild oben und links) sagt: „Das ÖBH2032+ sieht den Einsatz von Kradmeldern in Bataillonen vor. Daher beginnen wir mit der Ausbildung der zukünftigen Heeresfahr(schul)lehrer für geländegängige Motorräder. Ziel ist, dass die ersten Kradlehrer für Kradausbildungen bereitstehen, wenn in den nächsten Jahren neue geländegängige Motorräder bei der Truppe verfügbar sind.“ Dazu verwendet das Referat neun bereits erprobte Kräder der Marke Husqvarna 701 Enduro. Eine Fahrschule dauert für zivile A-Schein-Besitzer eine Woche und zwei Wochen für Fahranfänger. Insgesamt drei Schüler und ein Fahrlehrer bilden eine Motorrad-Fahrschulgruppe.
Fazit
Der Kradmelder ist eine kostengünstige, durch feindliche EloKa ungestörte Verbindung zur Informationsübertragung. Der Kradmeldertrupp muss das Orientieren und den abgesetzten Einsatz beherrschen sowie ein tiefes Verständnis für die Vorgänge und Anforderungen von kleinen und großen Verbänden besitzen. Im Zusammenwirken mit weitreichenden Funkmitteln, Drohnen und flexiblem Einsatz kann er aufklären, Meldungen überbringen, am Marsch sichern und Panzer vernichten. Derzeit sind Kradmelder im Bundesheer mit deutlich geändertem Aufgabenspektrum nur bei der Militärpolizei und in Spezialeinsatzkräften vorhanden. Eine Rückkehr von Kradmeldertrupps in die Truppe könnte eine markante Kampfwertsteigerung darstellen und Kommandanten ein leistungsfähiges Mittel zur Bewältigung von zahlreichen Aufgaben auf dem Gefechtsfeld in die Hand geben.
Oberleutnant Maximilian Staudinger BA; Kommandant der 2. Panzergrenadierkompanie des Panzergrenadierbataillons 13

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).